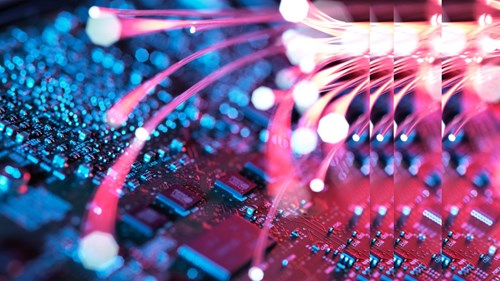Corporate-Newsletter Februar 2016
Rechtsprechung
Haftung des GmbH-Geschäftsführers bei Einziehung von Forderungen auf ein debitorisches Konto einer insolventen GmbH
BGH, Urteil vom 8. Dezember 2015 – II ZR 68/14
Der Beklagte war Geschäftsführer einer insolventen GmbH, der Kläger Insolvenzverwalter der GmbH. Die GmbH hatte ein durchgehend im Soll geführtes Kontokorrentkonto. Im Rahmen der Kontovereinbarung hatte die GmbH sämtliche gegenwärtigen und künftigen Ansprüche gegen alle Drittschuldner aus ihrem Geschäftsverkehr zur Sicherung an die kontoführende Bank abgetreten. Auch nach Eintritt der Insolvenzreife zog die GmbH Forderungen gegen Drittschuldner auf besagtes Konto ein, wodurch sich der Debetsaldo verringerte. Der Insolvenzverwalter fordert nun Schadensersatz gegen den Geschäftsführer in Höhe der nach Insolvenzreife auf das Konto eingezogenen Forderungen. Als Rechtsgrundlage der Forderung berief er sich auf § 64 S. 1 GmbHG.
Der BGH stellte fest, dass ein solcher Einzug von Forderungen einer insolvenzreifen GmbH auf ein debitorisches Konto grundsätzlich eine masseschmälernde Zahlung im Sinn von § 64 S. 1 GmbHG sei, weil dadurch das Aktivvermögen der Gesellschaft zu Gunsten der Bank geschmälert werde. Der auf das debitorische Konto eingezahlte Betrag werde aufgrund der Kontokorrentabrede mit dem Sollsaldo bzw. mit dem Kreditrückzahlungsanspruch der Bank verrechnet. Dadurch zahle die Gesellschaft – nach Insolvenzreife – Geld an einen Gläubiger, nämlich die Bank und schmälere die Masse zulasten anderer Gläubiger.
Anschließend wandte der BGH sich dem zwischen der GmbH und der Bank geschlossene Globalabtretungsvertrag zu. Dessen Existenz könne dagegen sprechen, dass Einziehungen von Forderungen auf das debitorisch geführte Konto als Annahme masseschmälernder Zahlungen im Sinne von § 64 S. 1 GmbHG zu werten seien (Bestätigung von BGH, Urteil vom 23. Juni 2015 – II ZR 366/13 – Noerr Newsletter Ausgabe August 2015). Entscheidend für die Wertung des BGH ist offenbar, ob der Geschäftsführer die Zahlung auf das Konto noch hätte verhindern können oder nicht: Eine masseschmälernde Leistung durch die der Bank zugutekommende Zahlung kann nach Auffassung des BGH dann vorliegen, wenn eine vor Insolvenzreife zur Sicherheit abgetretene zukünftige Forderung erst nach Eintritt der Insolvenzreife entstanden ist, oder wenn sie zwar vor Eintritt der Insolvenzreife entstanden, aber erst danach werthaltig geworden ist und der Geschäftsführer die Entstehung der Forderung oder deren Werthaltigwerden hätte verhindern können. Der Geschäftsführer könne zwar nicht verhindern, dass die Bank die ihr zur Sicherheit abgetretene Forderung nach Insolvenzreife verwertet. Er dürfe aber nicht bewirken, dass die Bank zu Lasten der Masse noch nach Insolvenzreife eine werthaltige Forderung erwirbt, § 64 S. 1 GmbHG.
Im Falle der Abtretung einer künftigen Forderung sei der Verfügungstatbestand mit dem Zustandekommen des Abtretungsvertrages abgeschlossen. Der Rechtsübergang auf den Gläubiger vollziehe sich jedoch erst mit dem Entstehen der Forderung. Wenn ‑ wie hier ‑ die Abtretung bereits vor der Insolvenzreife für künftige Forderungen vereinbart wurde, kann gleichwohl eine Masseschmälerung eintreten. Deren Ursache liege nicht in der Abtretungsvereinbarung, sondern darin, dass die sicherungsabgetretene Forderung nicht mehr zugunsten des Vermögens der GmbH, sondern zugunsten des Zessionars entsteht. Wenn der Geschäftsführer die Zession ‑ etwa durch die Kündigung des Kontokorrentvertrages ‑ oder das Entstehen der Forderung nach Eintritt der Insolvenzreife verhindern könne, liege daher im Ergebnis eine von ihm veranlasste Leistung an die Bank vor, wenn die Forderung nach der Sicherungsabtretung an die Bank entsteht und von ihr verwertet wird.
Das betrifft aus Sicht des BGH vor allem Verträge, die der Insolvenzschuldner nach Eintritt der Insolvenzreife eingeht und bei denen der Anspruch auf die Gegenleistung für eine Leistung des Insolvenzschuldners aufgrund der Sicherungsabtretung der Bank zusteht. Das gleiche gelte, wenn der Anspruch auf die Gegenleistung rechtlich zwar bereits entstanden sei, zulasten des Vermögens der Schuldnerin aber erst nach Eintritt der Insolvenzreife werthaltig gemacht werde, etwa indem der Insolvenzschuldner die von ihm vertraglich zugesagte Leistung erbringt. Die Wertschöpfung geschehe dann zu Lasten der Gläubigergesamtheit bzw. der Masse und zugunsten des gesicherten Gläubigers.
Fortbestehende Identität einer GbR bei Gesellschafterwechsel
BGH, Urteile vom 3. November 2015 – II ZR 443/13 und II ZR 446/13
Die Kläger waren ursprünglich Gesellschafter einer GbR. Nach ihrem Ausscheiden schlossen sie und zwei weitere ausgeschiedene Gesellschafter eine notarielle Vereinbarung mit der GbR sowie den in der GbR verbliebenen bzw. inzwischen neu hinzugetretenen Gesellschaftern, um Abfindungsansprüche zu regeln. Sollte der vereinbarte Abfindungsbetrag nicht bezahlt werden, gewährte diese Vereinbarung den Altgesellschaftern unter bestimmten weiteren Voraussetzungen ein „Wahlrecht“, von den derzeitigen Gesellschaftern „100 % der Gesellschaft (…) zu übernehmen“. Die ausgeschiedenen Gesellschafter (Kläger) übten dieses Wahlrecht aus. Über die Wirksamkeit und damit die Gesellschafterstellung der Kläger herrscht Streit. Rechtlicher Anknüpfungspunkt war ein Vollstreckungsbescheid der Beklagten gegen die GbR, gegen die sich die Kläger als (vermeintliche) Gesellschafter der GbR mit einer Vollstreckungsabwehrklage wehrten.
Der BGH verneinte in den vorliegenden Entscheidungen die Prozessführungsbefugnis der Kläger. Die Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO sei von „dem Schuldner“ zu erheben. Vollstreckungsschuldnerin und damit zur Erhebung der Vollstreckungsabwehrklage befugt sei im Streitfall aber die GbR. Der vorgenannten notariellen Vereinbarung sei zu entnehmen, dass die ursprünglich ausgeschiedenen Gesellschafter durch Ausübung ihres Wahlrechts die Gesellschaftsanteile und nicht lediglich ‑ als neu begründete Gesellschaft ‑ das gesellschaftseigene Vermögen übernehmen.
Durch Ausübung des Wahlrechts zum Erwerb der Gesellschaftsanteile habe sich die Identität der GbR nicht geändert. Dies gelte auch bei einem Austausch des gesamten Gesellschafterbestandes. Der BGH habe bereits in der Vergangenheit entschieden, dass bei einer Personenhandelsgesellschaft alle Gesellschafter gleichzeitig durch Abtretung ihrer Gesellschaftsanteile aus der Gesellschaft ausscheiden und an ihre Stelle die Erwerber der Gesellschaftsanteile treten können, ohne dass dadurch der Fortbestand der Gesellschaft berührt werde. Für die ‑ als rechtsfähig anerkannte ‑ (Außen-)GbR könne nichts anderes gelten. Zwar seien bei einer GbR, die nicht in einem öffentlichen Register eingetragen ist, die Namen der Gesellschafter eine bedeutsame Identifizierungshilfe. Gleichwohl sei auch in einer GbR ein Gesellschafterwechsel bei identischem Fortbestand der Gesellschaft nach allgemeiner Ansicht möglich, obwohl jeder Wechsel eines oder mehrerer Gesellschafter die Funktion des Gesellschafterbestandes als Identifizierungshilfe im Rechtsverkehr beeinträchtigen könne. Eine quantitative Begrenzung des Gesellschafterwechsels auf ein noch zulässiges Maß lasse sich nicht sinnvoll vornehmen. Schon deshalb könne auch ein vollständiger Austausch des gesamten Gesellschafterbestandes nicht untersagt werden, der je nach Lage des Falles keine erheblich größere Irritation des Rechtsverkehrs hervorrufen müsse als der Wechsel eines (großen) Teils der Gesellschafter. Im Übrigen bleibe es Aufgabe der (neuen) Gesellschafter, mögliche Zweifel an dem identischen Fortbestand der Gesellschaft auszuräumen.
Nach Anerkennung der Rechtsfähigkeit der (Außen-)GbR kann nach Ansicht des BGH ein Aktivprozess der GbR nicht weiterhin von den Gesellschaftern „als GbR“ geführt werden. Vielmehr sei in derartigen Rechtstreitigkeiten grundsätzlich die rechtsfähige Gesellschaft die richtige Partei.
Auch die akzessorische Gesellschafterhaftung, der die Gesellschafter einer rechtsfähigen GbR in entsprechender Anwendung der §§ 128, 129 HGB unterliegen, bietet aus Sicht des BGH keine tragfähige Begründung dafür, den Gesellschaftern die Prozessführungsbefugnis zuzubilligen. Dies folge schon daraus, dass aus einem gegen die Gesellschaft gerichteten Schuldtitel nicht gegen die Gesellschafter vollstreckt werden könne (§ 129 Abs. 4 HGB) und dass den Gesellschaftern Einwendungen erhalten bleiben, auf die auch die Gesellschaft eine Vollstreckungsabwehrklage allein stützen könnte (§ 767 Abs. 2, § 796 Abs. 2 ZPO).
Herabsetzung der Vorstandsbezüge in der Krise der AG
BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 – II ZR 296/14
In der vorliegenden Entscheidung äußerte sich der BGH zu einigen grundlegenden Aspekten der in § 87 Abs. 2 AktG niedergelegten Möglichkeit zur Herabsetzung der Vorstandsvergütung. Der Kläger war Vorstandsmitglied einer AG, über deren Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Der Beklagte wurde als Insolvenzverwalter bestellt. Auf schriftliche Aufforderung des Insolvenzverwalters beschloss der Aufsichtsrat, die Vergütung der Vorstandsmitglieder ab Insolvenzeröffnung auf einen Maximalbetrag von EUR 2.500 zu begrenzen. Der Kläger fordert darüber hinausgehende Vergütungsansprüche ein.
Das OLG Stuttgart als Vorinstanz (vgl. Noerr Newsletter Ausgabe Dezember 2014) entschied in seinem Urteil vom 1. Oktober 2014 – 20 U 3/13, dass dieser Beschluss gegenüber dem klagenden Vorstandsmitglied unwirksam sei. Der BGH hob das Urteil des OLG Stuttgart auf, das nun erneut wird entscheiden müssen.
Zunächst stellte der BGH fest, dass das Recht zur Herabsetzung der Bezüge gemäß § 87 Abs. 2 AktG ein einseitiges Gestaltungsrecht der AG sei, das durch eine Gestaltungserklärung ausgeübt werde. Zuständig für die Abgabe der Gestaltungserklärung gegenüber dem Vorstandsmitglied sei der Aufsichtsrat (§ 112 AktG). Die Kundgabe des zugrundeliegenden Herabsetzungsbeschlusses gegenüber dem Vorstandsmitglied genüge in der Regel, um die Gestaltungswirkung und damit die Änderung der Vergütungsvereinbarung eintreten zu lassen. Dabei erfasse der Anwendungsbereich des § 87 Abs. 2 AktG auch die Zeit nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der AG. Da die Vorstandsmitglieder jedoch grundsätzlich darauf vertrauen dürften, die vertraglich vereinbarte Vergütung bis zum Ablauf ihres Anstellungsvertrages in voller Höhe zu erhalten, sei § 87 Abs. 2 AktG zwar im Lichte der Artikel 2 Abs. 1, Artikel 14 Abs. 1 GG restriktiv auszulegen. Eine Privilegierung gerade für die Zeit nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens, etwa im Hinblick auf das außerordentliche Kündigungsrecht des Insolvenzverwalters nach § 113 InsO, sei jedoch nicht geboten. Sie würde im Falle einer Kündigung des Anstellungsvertrages durch den Insolvenzverwalter dazu führen, dass die Vergütungen, die während der dreimonatigen Kündigungsfrist des § 113 Satz 2 InsO als Masseverbindlichkeiten anfallen, in der ursprünglichen, dann aber unangemessenen Höhe gezahlt werden müssten.
Ausdrücklich offen gelassen hat der BGH die Frage, ob das Recht aus § 87 Abs. 2 AktG für die Zeit nach Insolvenzeröffnung nur vom Insolvenzverwalter ausgeübt werden könne. Darauf kam es im vorliegenden Fall nicht an, da der Insolvenzverwalter zumindest der Maßnahme zugestimmt und seine Zuständigkeit auch nicht geltend gemacht habe. In diesem Fall dürfe sich nach Treu und Glauben keiner der Beteiligten auf eine fehlende Zuständigkeit des Aufsichtsrats berufen.
Das OLG Stuttgart hatte in der Vorinstant festgestellt, dass der Beschluss, der weder die betroffenen Vorstandsmitglieder noch die Höhe der Herabsetzung erkennen ließ, wegen inhaltlicher Unbestimmtheit unwirksam sei. Dem widersprach der BGH. Auch wenn Aufsichtsratsbeschlüsse aus Gründen der Rechtssicherheit ausdrücklich gefasst werden müssten, seien sie gleichwohl der Auslegung zugänglich. Diese sei nicht auf den Wortlaut des Beschlusses beschränkt, sondern könne auch außerhalb des Beschlusstextes zum Ausdruck kommende Umstände einbeziehen. Der Aufsichtsrat habe vor der Beschlussfassung das Schreiben des Insolvenzverwalters betreffend die Aufforderung zur Vergütungsherabsetzung erörtert und als Grundlage für seine Entscheidung genommen. Aus dem Schreiben hätten sich der betroffene Personenkreis und die Höhe der Herabsetzung ergeben.
Der Herabsetzungsbeschluss ist nach Meinung des BGH auch nicht wegen einer mangelnden Ermessensausübung seitens des Aufsichtsrats unwirksam. Auch hier hatte das OLG Stuttgart gegensätzlich geurteilt. Der BGH sieht auch im Fehlen eigener Erwägungen des Aufsichtsrats zur Angemessenheit des Herabsetzungsbetrag keinen Mangel, der auf die Wirksamkeit der Gestaltungserklärung durchschlagen könne. Das Vorstandsmitglied sei hinreichend dadurch geschützt, dass es unabhängig davon gerichtlich überprüfen lassen könne, ob die Herabsetzung seiner Bezüge sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach den gesetzlichen Vorgaben des § 87 Abs. 2 AktG entspreche.
Ferner klärte der BGH, dass die Insolvenzreife der Gesellschaft jedenfalls ein hinreichender Grund für eine Vergütungsherabsetzung nach § 87 Abs. 2 AktG sei. Dabei kommt es nach Auffassung des BGH nicht darauf an, dass das Vorstandsmitglied pflichtwidrig gehandelt habe. Es genüge bereits, dass die Verschlechterung der Lage der Gesellschaft in die Zeit seiner Vorstandsverantwortung falle und ihm zurechenbar sei. Die Regelung des § 87 Abs. 2 AktG erlaube in diesem Rahmen im Übrigen nicht nur die Herabsetzung der Bezüge aktiver Vorstandsmitglieder, sondern betreffe auch die Bezüge ausgeschiedener Vorstandsmitglieder. Erfasst würden daher auch Ansprüche auf Auszahlung der für die Restlaufzeit des Vertrages anfallenden Bezüge bei Entlassung oder bei Abberufung des Vorstandsmitglieds ohne (gleichzeitige) Kündigung seines Anstellungsvertrags.
In dem Urteil betont der BGH noch einmal, dass der Aufsichtsrat bei Vorliegen der Voraussetzungen im Regelfall zu einer Herabsetzung verpflichtet sei und nur bei Vorliegen besonderer Umständen hiervon absehen dürfe. Offenbar billigt der BGH dem Aufsichtsrat entgegen der in der Literatur wohl herrschenden Auffassung keinen eigenen Ermessensspielraum zu, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Entscheidung des Aufsichtsrats ist gerichtlich voll überprüfbar. Konsequenz wäre, dass eine eigene Haftung des Aufsichtsrats für eine Fehleinschätzung nur auf der Verschuldensebene abgewendet werden könnte.
Im Hinblick auf die Höhe der Vergütungsherabsetzung stellte der BGH klar, dass die Herabsetzung mindestens auf einen Betrag erfolgen müsse, dessen Gewährung angesichts der Verschlechterung der Lage der Gesellschaft nicht mehr als unbillig im Sinne des § 87 Abs. 2 S. 1 AktG angesehen werden kann. Allerdings sei die Befugnis zur (einseitigen) Herabsetzung nach § 87 Abs. 2 AktG dahingehend beschränkt, dass die Bezüge (nur) auf den danach höchstmöglichen angemessenen Betrag herabgesetzt werden dürfen.
Bei der rechtlichen Prüfung der Billigkeit im Sinne des § 87 Abs. 2 S. 1 AktG seien sämtliche Umstände des Einzelfalles einschließlich der persönlichen Verhältnisse des Vorstandsmitglieds zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen. Insbesondere sei einerseits der Umfang der Verschlechterung der Lage der Gesellschaft gegenüber dem Zeitpunkt der Vereinbarung der Vergütung sowie andererseits zu berücksichtigen, in welchem Grad die Verschlechterung dem Vorstandsmitglied zurechenbar sei und ob er sie gegebenenfalls sogar pflichtwidrig herbeigeführt habe.
Eine Koppelung der herabgesetzten Vorstandsvergütung an die Gehälter der leitenden Angestellten als Untergrenze lehnte der BGH ab. Die Angestellten eines Unternehmens seien nicht verpflichtet, aufgrund einer besonderen, nur die Organmitglieder treffenden Treuebindung eine einseitig von der Gesellschaft verfügte Gehaltskürzung hinzunehmen. Angenommen es gäbe eine entsprechende Untergrenze, könnte es in Fällen, in denen die Gehälter der leitenden Angestellten nahe an diejenigen der Vorstände heranreichen, dazu kommen, dass die Vorstandsvergütung auch nach der Herabsetzung noch ‑ gemessen an anderen Unternehmen ‑ unbillig hoch sei. Dass ein Vorstandsmitglied nur deshalb von einer Herabsetzung seiner Vergütung verschont bleibe, weil den leitenden Angestellten im Zweifel unangemessen hohe Gehälter gezahlt würden, entspreche aber nicht dem Sinn des § 87 Abs. 2 AktG. In der Krise der Gesellschaft ein geringeres Gehalt als die leitenden Angestellten zu bekommen, stelle auch keinen dem Vorstandsmitglied unzumutbaren Makel dar, sondern sei vielmehr Ausdruck der besonderen Treuebindung des Vorstands.
Bei der Abwägung nach § 87 Abs. 2 AktG ist schließlich aus Sicht des BGH auch zu berücksichtigen, dass wegen der Verschlechterung der Lage der Gesellschaft gegebenenfalls der variable Teil der Vorstandsvergütung mangels erwirtschafteten Gewinns wegfällt und das Vorstandsmitglied auch schon deshalb eine Gehaltseinbuße erleidet. Damit entspricht der BGH einem bereits in der Literatur entwickelten Standpunkt.
Ausgleichsanspruch eines Gesellschafters bei nicht vorhandenem Gesellschaftsvermögen
BGH, Urteil vom 13. Oktober 2015 – II ZR 214/13
Der Kläger macht aus abgetretenem Recht einen Ausgleichsanspruch nach Auflösung einer GbR geltend. Der Zedent und der Beklagte gründeten eine GbR. Der vom Zedenten auf den Kläger abgetretene Ausgleichsanspruch beinhaltete einen Ausgleich dafür, dass der Zedent in der Vergangenheit einen höheren Betrag in die GbR eingelegt hatte als der Beklagte. Darüber hinaus waren von der Abtretung weitere Ausgleichsansprüche aus einer Liquidationsschlussbilanz der GbR erfasst. Der Kläger hält die GbR für aufgelöst, da die Erreichung ihres Zwecks nach Veräußerung aller Aktiva und Bereinigung aller Passiva der GbR unmöglich geworden sei. Zwischen Kläger und Beklagten herrscht nun Streit, ob die (einfachen) Aufstellungen und Berechnungen des Klägers über die Höhe seines Ausgleichsanspruchs zur Geltendmachung seines Anspruchs ausreichen und ob der Kläger vorliegend einen Anspruch aus § 735 BGB geltend macht, der eigentlich der GbR zusteht und den der Zedent nicht abtreten konnte.
Unter Berufung auf seine frühere Rechtsprechung stellte der BGH zunächst fest, dass es nach Auflösung einer GbR zur Geltendmachung des Auseinandersetzungsguthabens keiner ‑ von den Gesellschaftern festgestellten ‑ Auseinandersetzungsbilanz bedarf, wenn kein zu liquidierendes Gesellschaftsvermögen mehr vorhanden ist. In diesem Fall könne der Gesellschafter, der für sich ein Guthaben beansprucht, dieses aufgrund einer vereinfachten Auseinandersetzungsrechnung unmittelbar gegen den ausgleichspflichtigen Gesellschafter geltend machen. Streitpunkte über die Richtigkeit der Schlussrechnung seien in diesem Prozess zu entscheiden.
Eine vereinfachte Auseinandersetzungsrechnung müsse den geltend gemachten Ausgleichsanspruch nachvollziehbar und schlüssig darlegen. Zu diesem Zweck seien die für die Berechnung wesentlichen Parameter einzubeziehen. Außerdem gelte auch für die an die Liquidation anschließenden Ausgleichsansprüche der Gesellschafter untereinander zur Vermeidung eines Hin- und Herzahlens der Grundsatz der Gesamtabrechnung und es bestehe grundsätzlich eine Durchsetzungssperre hinsichtlich einzelner Rechnungsposten. Weitergehende Anforderungen sind an eine vereinfachte Auseinandersetzungsrechnung aus Sicht des BGH nicht zu stellen.
Auch stellte der BGH klar, dass der Kläger keinen der Gesellschaft zustehenden Anspruch aus § 735 BGB geltend gemacht habe. Der Gesellschafter, der nach der Auflösung einer GbR für sich ein Guthaben beansprucht, könne dieses unmittelbar gegen den ausgleichspflichtigen Gesellschafter geltend machen, wenn kein (sonstiges) zu liquidierendes Gesellschaftsvermögen mehr vorhanden ist. Bei dieser vereinfachten Abwicklung mache der Gesellschafter einen eigenen Anspruch geltend, nicht etwa einen Anspruch der Gesellschaft, der auf Leistung an diese zu richten wäre. Da der Ausgleichsanspruch unter den genannten Voraussetzungen dem Ausgleichsberechtigten unmittelbar gegen den ausgleichspflichtigen Mitgesellschafter zustehe, könne er ihn auch abtreten.
Rückwirkende Anwendung eines neueren Bewertungsstandards bei Barabfindung
BGH, Beschluss vom 29. September 2015 – II ZB 23/14
Im Spruchverfahren um den 2003 beschlossenen Ausschluss der Minderheitsaktionäre bei der Stinnes AG hat der BGH entschieden, dass das Gericht bei der Schätzung des Unternehmenswertes im Spruchverfahren auch fachliche Berechnungsweisen zugrunde legen dürfe, die erst nach dem Bewertungsstichtag entwickelt wurden. Dem stehe weder der Gedanke der Rechtssicherheit noch der Vertrauensschutz entgegen. Das Stichtagsprinzip werde von der Anwendung einer neuen Berechnungsweise nicht verletzt, solange die neue Berechnungsweise nicht eine Reaktion auf nach dem Stichtag eingetretene und zuvor nicht angelegte wirtschaftliche oder rechtliche Veränderungen, insbesondere in steuerlicher Hinsicht, sei.
Ziel der Bewertung sei es, den Grenzpreis zu ermitteln, zu dem das Unternehmen am Stichtag an einen Dritten hätte verkauft werden könnten. Dieses Ziel würde nach Auffassung eines Teils der Rechtsprechung bei Einbeziehung erst später entwickelter Bewertungsmethoden verfehlt, weil die neuen Methoden in den vom Dritten bezahlten Grenzpreis nicht einfließen würden. Dieser Argumentation schließt sich der BGH nicht an. Die Kenntnis einer fundamentalanalytischen Bewertungsmethode ist aus Sicht des BGH nicht Voraussetzung für das Zustandekommen richtiger Marktpreise, in die auch andere Faktoren und Informationen einfließen. Mit der fundamentalanalytischen Berechnung solle ein Marktpreis theoretisch geschätzt werden, der mangels „echten“ Verkaufsfalls gerade nicht unmittelbar nachvollzogen werden könne, und kein Marktpreis gebildet werde.
Letztlich stünde auch nicht der Rechtsgedanke von Artikel 170 EGBGB zur Anwendung intertemporalen Rechts der Anwendung einer neuen Berechnungsweise entgegen. Denn Bewertungsmethoden seien keine Rechtsnormen und ähnelten ihnen auch nicht. Erst recht gelte das für von der Wirtschaftswissenschaft oder der Wirtschaftsprüferpraxis entwickelte Berechnungsweisen, selbst wenn sie als „Bewertungsstandards“ schriftlich festgehalten seien.
Umsatzsteuerliche Organschaft mit Tochterpersonengesellschaften
BFH, Urteil vom 2. Dezember 2015 – V R 25/13
Der BFH hat seine Rechtsprechung zur Eingliederung von Personengesellschaften als Organgesellschaften in umsatzsteuerlichen Organschaften geändert. Sie ist nun unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
Eine umsatzsteuerliche Organschaft führt grundsätzlich dazu, dass nur der jeweilige Organträger, nicht aber die eingegliederten Organgesellschaften Steuerschuldner für Umsatzsteuerzwecke ist. Dem Organträger obliegen damit in Bezug auf den umsatzsteuerlichen Organkreis auch die umsatzsteuerlichen Deklarationspflichten. Dies betrifft beispielsweise Pflichten zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen und von Umsatzsteuererklärungen. Zudem unterliegen Umsätze, die die Beteiligten einer umsatzsteuerlichen Organschaft untereinander erbringen, nicht der Umsatzsteuer. Entsprechend kann die Errichtung einer umsatzsteuerlichen Organschaft zu steuerlichen Erleichterungen führen (z.B. aufgrund eines verringerten Deklarationsaufwands).
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG ist die maßgebliche Vorschrift für eine umsatzsteuerliche Organschaft. Danach liegt eine umsatzsteuerliche Organschaft vor, wenn eine juristische Person nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist. Im Anschluss an die Vorlageentscheidung des EuGH vom 16. Juli 2015 (Az. C‑108/14, C‑109/14) lässt der BFH in seiner aktuellen Entscheidung nunmehr im Wege der sogenannten „teleologisch erweiternden Auslegung“ umsatzsteuerliche Organschaften auch mit Personengesellschaften als Organgesellschaften zu. Dafür sei aber erforderlich, dass Gesellschafter einer solchen Personengesellschaft nur der Organträger und andere vom Organträger finanziell eingegliederte Personen sind. § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG beschränke zwar den Kreis möglicher umsatzsteuerlicher Organgesellschaften auf juristische Personen, was wegen des bei Personengesellschaften grundsätzlich bestehenden Einstimmigkeitsprinzips und des fehlenden Formenzwangs auch sachlich gerechtfertigt sei. Allerdings sei der Ausschluss einer Personengesellschaft als umsatzsteuerlicher Organgesellschaft dann nicht mit dem Prinzip der Rechtsformneutralität des EU-Rechts vereinbar, wenn diese vergleichbar einer juristischen Person in das Unternehmen des Organträgers finanziell eingegliedert sei. Dies ist nach Ansicht des BFH bei Tochterpersonengesellschaften der Fall, bei denen neben dem Organträger nur Personen Gesellschafter sind, die nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG in das Unternehmen des Organträgers finanziell eingegliedert sind, da dann die erforderliche Durchgriffsmöglichkeit für den Organträger selbst bei Anwendung des Einstimmigkeitsprinzips gewährleistet sei. Ist neben dem Organträger eine Personengesellschaft Mitgesellschafter einer Tochterpersonengesellschaft (z.B. im Fall einer „doppelstöckigen“ Personengesellschaftsstruktur), komme es dementsprechend darauf an, dass auch in Bezug auf die Gesellschafter der übergeordneten Personengesellschaft eine finanzielle Eingliederung ausnahmslos in einer bis zum Organträger reichenden umsatzsteuerlichen Organkette zu bejahen ist.
Eine weitergehende umsatzsteuerliche Organschaft, die allgemein eine Eingliederung von Personengesellschaften in den umsatzsteuerlichen Organkreis ermöglichen würde, lehnt der BFH weiterhin ab. Dies sei auch nach EU-Recht nicht geboten. Die Einschränkung der umsatzsteuerlichen Organschaft auf die Eingliederung juristischer Personen als Organgesellschaften diene nicht dazu, die Umsatzbesteuerung rechtsformabhängig auszugestalten, sondern solle den europarechtlich auch vom EuGH anerkannten Präzisierungsvorbehalt rechtssicher ausfüllen. Könne aufgrund der Besonderheiten des nationalen Gesellschaftsrechts im Regelfall nur bei juristischen Personen rechtssicher über die umsatzsteuerlich relevanten Eingliederungsvoraussetzungen entschieden werden, rechtfertige dies die grundsätzliche gesetzgeberische Einschränkung auf eine Eingliederung juristischer Personen als Organgesellschaften.
Es ist bereits aktuell davon auszugehen, dass diese Entscheidung des BFH erhebliche Auswirkungen in der Praxis haben wird. Dies sollte prinzipiell für die Zukunft, aber auch im Hinblick auf verfahrensrechtlich noch offene Altfälle, die potentiell umsatzsteuerliche Organschaften mit Tochterpersonengesellschaften darstellen könnten, gelten. In Bezug auf die Handhabung von Altfällen wird derzeit – auch betreffend der Reichweise der Vertrauensschutzregelungen des § 176 AO – eine diesbezügliche Äußerung der Finanzverwaltung erwartet.
Pressemitteilung des BFH
Verzicht auf Umsatzsteuerbefreiung einer Grundstückslieferung
BFH, Urteil vom 21. Oktober 2015 – XI R 40/13
Nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG sind Umsätze, die unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen, von der Umsatzsteuer befreit. Der leistende Unternehmer kann einen derartigen Umsatz jedoch als steuerpflichtig behandeln, wenn der Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird (§ 9 Abs. 1 UStG) und dieser, der Leistungsempfänger, das Grundstück ausschließlich für Umsätze verwendet oder zu verwenden beabsichtigt, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen (§ 9 Abs. 2 S. 1 UStG). Gemäß § 9 Abs. 3 S. 2 UStG kann der Verzicht auf die Steuerbefreiung nach § 9 Abs. 1 UStG bei Lieferungen von Grundstücken (außerhalb eines Zwangsversteigerungsverfahrens) jedoch nur in dem gemäß § 311b Abs. 1 BGB notariell zu beurkundenden Vertrag erklärt werden.
Der BFH hat nun – entgegen einer bislang u.a. auch in der Finanzverwaltung vertretenen Ansicht ‑ entschieden, dass § 9 Abs. 3 S. 2 UStG eine zeitliche Begrenzung für die Ausübung des Verzichts auf die Umsatzsteuerbefreiung enthält. Die Vorschrift des § 9 Abs. 3 UStG ermögliche ihrem Wortlaut nach den Verzicht nur in dem der Grundstückslieferung zugrunde liegenden notariell zu beurkundenden Vertrag, nämlich in dem Vertrag, in dem das Eigentum an einem Grundstück übertragen oder erworben wird. Das ist der Verpflichtungsvertrag, der der Auflassung und der Eintragung in das Grundbuch vorhergeht. Die Verzichtsoption sei also zeitlich bereits ausgeschlossen, wenn die Parteien den Verpflichtungsvertrag nachfolgend (nunmehr unter Einschluss der Verzichtserklärung) neu fassen, und zwar auch dann, wenn diese Neufassung gleichfalls notariell beurkundet wurde. Der Zeitpunkt, zu dem der notarielle Kaufvertrag abgeschlossen wird, solle somit letztmöglicher Zeitpunkt für die Erklärung des Verzichts auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG sein. Die umsatzsteuerliche Vorschrift diene dem Schutz des Leistungsempfängers vor einer nachträglichen Ausübung der Option durch den leistenden Unternehmer, durch die eine nachträgliche Steuerschuld beim Leistungsempfänger entstehen würde.
Siehe hierzu auch den Beitrag von Ulrike Sommer und Dr. Michaela Engel
Leitungsmacht als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des § 5 Abs. 3 MitbestG
KG Berlin, Beschluss vom 21. Dezember 2015 – 14 W 105/15
In diesem Statusverfahren geht es um die Verpflichtung einer Zwischengesellschaft zur Bildung eines Aufsichtsrats nach den Vorschriften des MitbestG. Die Zwischengesellschaft hielt jeweils alle Geschäftsanteile an insgesamt zehn GmbHs. Diese zehn Gesellschaften hatten insgesamt 4.500 Arbeitnehmer. Die Anteile an der Zwischengesellschaft hielt ebenfalls zu 100% eine Konzernleitungsgesellschaft mit Sitz in Frankreich. Die Zwischengesellschaft war der Ansicht, keinen Aufsichtsrat nach den Vorschriften des MitbestG gründen zu müssen, da sie kein „herrschendes Unternehmen“ im Sinne von § 5 Abs. 3 MitbestG sei. Sie übe keine Leitungsmacht über die von ihr beherrschten Unternehmen aus.
Dieser Ansicht schloss sich das KG Berlin in dem nun ergangenen Beschluss nicht an. Die Zwischengesellschaft als Antragsgegnerin müsse für eine Anwendung des § 5 Abs. 3 MitbestG keine eigene Leitungsmacht ausüben. Eine qualifizierte oder wenigstens einfache Leitung oder ein Mindestmaß an eigener tatsächlich ausgeübter Leitungsmöglichkeit auf Seiten der Zwischengesellschaft sei als ergänzendes Merkmal des § 5 Abs. 3 MitBestG nicht zu fordern. Dass der bei einer Zwischengesellschaft gebildete mitbestimmte Aufsichtsrat auf Grund seiner Position im Gesamtkonzern hinter den üblichen Einflussmöglichkeiten eines mitbestimmten Aufsichtsrates zurückbleiben oder sogar von der Mitwirkung an Konzernentscheidungen ganz abgeschnitten sein könne, nimmt das KG dabei bewusst in Kauf. Dieses Argument sei nach einer Gesamtabwägung letztlich noch kein überzeugender Grund, die Mitbestimmung bei einer Zwischengesellschaft gänzlich zu versagen. Zweck des § 5 Abs. 3 MitbestG sei eine Regelung der Fälle, in welchen ein mitbestimmter Aufsichtsrat bei der Konzernspitze, wo er zweifellos am effektivsten wäre, nicht bestellt werden kann. In diesen Fällen solle gemäß § 5 Abs. 3 MitbestG die Mitbestimmung nicht ganz entfallen. Vielmehr solle wenigstens bei einer nachgeordneten Zwischengesellschaft ein Aufsichtsrat gebildet werden. Das bedeute zwangsläufig, dass das Unternehmen, bei dem er gebildet wird, eben die Zwischengesellschaft, aufgrund ihrer im Tatbestand vorausgesetzten Einbindung in den Konzern im Regelfall die wesentlichen Leitungsfunktionen gerade nicht ausübe. Verlange man, dass die Zwischengesellschaft wesentliche Leitungsfunktionen selbst ausübt, wäre sie bereits herrschendes Unternehmen und man höhlte den Anwendungsbereich des § 5 Abs. 3 MitbestG aus. Ausreichend müsse also sein, dass wenigstens die Konzernmutter Leitungsmacht über die Zwischengesellschaft ausübt oder ausüben kann.
Ob etwas anderes in den Fällen gelten muss, in denen auch die Konzernleitung keine Leitungsmacht ausübt, musste das KG Berlin vorliegend nicht klären. Denn zwischen den Beteiligten war unstreitig, dass jedenfalls die Konzernleitung in Frankreich Leitungsmacht ausübte. Ferner ließ das KG Berlin offen, was gilt, wenn zwischen der Konzernleitung und der Zwischengesellschaft ein “Entherrschungsvertrag” geschlossen wurde.
Schadensersatz wegen fehlerhafter Kapitalmarktinformation
OLG Braunschweig, Urteil vom 12. Januar 2016 – 7 U 59/14
Das LG Braunschweig hatte mit Urteil vom 30. Juli 2014 – 5 O 401/13 – Schadensersatzansprüche von Anlegern im Zusammenhang mit einzelnen Pressemitteilungen der Porsche Holding zur versuchten Übernahme von VW im Jahr 2008 abgewiesen (vgl. Noerr Newsletter Ausgabe August 2014). Das OLG Braunschweig bestätigte nun diese Entscheidung. Eine Haftung nach §§ 37b, 37c WpHG scheide aus, da eine Pressemitteilung weder die Anforderungen an eine „Insiderinformation“ erfülle noch die Beklagte Emittentin der VW-Aktien gewesen sei.
Bei Pressemitteilungen handele es sich schon nach Bezeichnung, Adressatenkreis und Veröffentlichungsform nicht um Ad-hoc-Mitteilungen im Sinne von § 15 WpHG, auf die sich eine Haftung nach §§ 37b, 37c WpHG aber bezöge. Eine analoge Anwendung dieser Schadensersatzbestimmungen auf andere Informationen des Kapitalmarktes durch den Emittenten komme nicht in Betracht, da sich der Gesetzgeber durch Zurückziehen eines allgemeinen Kapitalmarktinformations-Haftungsgesetzes im Gesetzgebungsverfahren ausdrücklich gegen eine allgemeine Haftung für Informationen des Kapitalmarktes ausgesprochen habe.
Auch treffe eine Haftung nach §§ 37b, 37c WpHG lediglich den Emittenten eben derjenigen Papiere, die der Geschädigte im Vertrauen auf die Richtigkeit einer erfolgten oder das Fehlen einer Insiderinformation erworben oder veräußert hat. Die gegenteilige Auslegung des § 37b WpHG hätte zur Folge, dass mit dem Begriff der „Finanzinstrumente“ in § 37b Abs. 1 Hs. 1 WpHG etwas anderes gemeint wäre als mit demjenigen in § 37b Abs. 1 letzter Hs. Nr. 1 u. 2 WpHG. Dies sei widersprüchlich. Denn danach wären zuerst generell alle Finanzinstrumente gemeint, die von irgendeinem Emittenten herausgegeben worden sind, so dass sich die Vorschrift an alle Emittenten richten würde. Am Ende des Satzes wären dagegen nur diejenigen Finanzinstrumente gemeint, durch deren Erwerb bzw. Veräußerung der Schaden entstanden ist. Es liege auf der Hand, dass ein derartiger Doppelsinn desselben Begriffes innerhalb derselben Vorschrift vom Gesetzgeber nicht gemeint sein könne und der Dritte einen Schadensersatzanspruch nach §§ 37b, 37c WpHG nur gegen den Emittenten derjenigen Papiere haben soll, die er im Vertrauen auf die Informationslage erworben oder veräußert hat.
Aus Sicht des OLG Braunschweig scheidet auch ein Schadensersatzanspruch aus §§ 826, 31 BGB wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung des Anlegers aus. Die Schwelle für die Annahme einer sittenwidrigen Schädigung liege ausgesprochen hoch. Die im Bereich des Börsenhandels beanstandete Handlung müsse objektiv in Kreisen von Anlegern, börsennotierten Unternehmen und Börsenhändlern als sittenwidrig angesehen werden. Zudem müsse nach dortiger allgemeiner Geschäftsmoral und nach dem dort als „anständig“ Geltenden die besondere Verwerflichkeit des Verhaltens feststellbar sein. Diesem Maßstab genüge der Vortrag des Klägers zu den fraglichen Pressemitteilungen jedoch nicht. Die vom Kläger beanstandeten Pressemitteilungen der Beklagten seien in der konkreten damaligen Situation nicht grob unrichtig und gleichzeitig interpretationsfähig gewesen. Auch hätten die Pressemitteilungen unter Berücksichtigung des gesamten Ablaufs und der weiteren Marktinformationen der Beklagten nicht das Gesamtbild einer vorsätzlich falschen Marktinformation zur Verfolgung eines verwerflichen Zwecks entstehen lassen.
Pressemitteilung des OLG Braunschweig
GmbH-Gründung mittels einer Mischeinlage
OLG Celle, Beschluss vom 5. Januar 2016 – 9 W 150/15
Ein Gründungsgesellschafter hatte bei der Gründung einer GmbH einen Geschäftsanteil von EUR 15.000 übernommen. Im Gesellschaftsvertrag war geregelt, dass er einen Teil der Einlageverpflichtung durch die Übereignung eines PKW im Wert von knapp EUR 10.000 zu erbringen hat. Zudem sah der Gesellschaftsvertrag vor, dass neben der Einbringung des PKW vor der Handelsregistereintragung keine weitere Zahlung auf den Gesellschaftsanteil zu erbringen ist. Das zuständige Handelsregister hatte die Eintragung der GmbH ins Handelsregister abgelehnt, da lediglich der PKW vor der Handelsregisteranmeldung übereignet worden war.
Das OLG Celle stimmte der Rechtsauffassung des erstinstanzlichen Gerichts zu. Es ordnete die vorstehend beschriebene Einlagepflicht des Gründungsgesellschafters als Mischeinlage ein. Eine solche könne jedoch nur so gestaltet werden, dass die Sacheinlage (hier: Übereignung des PKW) vor Eintragung vollständig eingebracht werde (vgl. § 7 Abs. 3 GmbHG) und auf den Rest der übernommenen Einlage als Bareinlage ein Viertel einzuzahlen sei (vgl. § 7 Abs. 2 S. 1 GmbHG). Bei Gründung müsse feststehen, in welcher Weise der Gründungsgesellschafter die übernommenen Einlagen zu erbringen verspricht, um die hinreichende Bestimmtheit der Abreden zu gewährleisten. Soweit ein Gründungsgesellschafter ‑ wie hier ‑ nur eine Teilsacheinlage verspreche, sei der Gesellschaftsvertrag dahin auszulegen, dass der Rest als Bareinlage versprochen werde.
Da der Gesellschaftsvertrag zudem vorsehe, dass neben der Einbringung des PKW vor der Eintragung keine weitere Zahlung auf den übernommenen Gesellschaftsanteil zu erbringen sei, werde der Gesellschafter durch diese Gestaltung unzulässig im Sinne von § 19 Abs. 2 GmbHG von der Ersteinzahlungspflicht auf Bareinlagen gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 GmbHG befreit, so dass die Gesellschaft ohne Änderung des Gesellschaftsvertrags nicht in das Handelsregister eingetragen werden könne. Nach Auffassung des OLG Celle darf ein Gründungsgesellschafter bei der hier gewählten Mischeinlage auf einen einzigen übernommenen Anteil nicht günstiger dastehen, als wenn der Gründungsgesellschafter zwei Geschäftsanteile übernommen hätte, nämlich eine Sacheinlage (Übereignung des PKW) und getrennt davon eine Bareinlage. In diesem Fall hätte der Gründungsgesellschafter den PKW insgesamt und auf den Bareinlageteil ein Viertel der Einlage bei Gründung aufbringen müssen.
Untergang des eingezogenen Geschäftsanteils nach Einziehungsbeschluss
OLG Dresden, Urteil vom 28. Oktober 2015 – 13 U 788/15
Der Kläger machte die Unwirksamkeit von Gesellschafterbeschlüssen geltend, mit denen die Gesellschaft einen Geschäftsanteil, den sie zuvor eingezogen hatte, teilte und die durch die Teilung entstandenen Geschäftsanteile abtrat.
Das OLG Dresden bejaht die Unwirksamkeit der genannten Beschlüsse, da nach der wirksamen Einziehung des Geschäftsanteils dessen Teilung und Abtretung nicht mehr möglich waren. Der Einziehungsbeschluss bewirkte den sofortigen Untergang des eingezogenen Geschäftsanteils, so dass er nicht mehr geteilt und übertragen werden könne. Die Einziehung setze zwar neben dem Gesellschafterbeschluss eine Mitteilung an den betroffenen Gesellschafter voraus. Mit der Bekanntgabe des Beschlusses an den betroffenen Gesellschafter werde sie aber sofort wirksam. Die Einziehung vernichte den Geschäftsanteil des betroffenen Gesellschafters und lasse sämtliche mit dem Geschäftsanteil verbundenen Mitgliedschaftsrechte und -pflichten untergehen. Aus der Entscheidung des BGH vom 2. Dezember 2014 (II ZR 322/13) ergebe sich nicht, dass die Gesellschafter die Rechtsfolgen einer Einziehung nach ihren Wünschen selbst regeln können. In dem Urteil werde zwar ausgeführt, es gebe gute Gründe, die Entscheidung, wie (nach dem Einziehungsbeschluss) weiter verfahren werden solle, den Gesellschaftern zu überlassen. Dies beziehe sich indes nicht auf die Rechtsfolgen der Einziehung selbst, sondern auf die Frage, welche Folgen eine sich aus der Einziehung ergebende, gemäß § 5 Abs. 3 S. 2 GmbHG unzulässige Abweichung der Summe der Nennbeträge aller Geschäftsanteile vom Stammkapital hat, die sich gerade daraus ergibt, dass die eingezogenen Geschäftsanteile untergehen. Von seiner Auffassung, dass die Einziehung zur Vernichtung des Geschäftsanteils führt, sei der Bundesgerichtshof damit nicht abgerückt.
Vollzugsverbot in der deutschen Fusionskontrolle auch für Vorbereitungshandlungen
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 9. Dezember 2015 – VI-Kart 1/15 (V)
Das OLG Düsseldorf hat im Verfahren zum beabsichtigten Zusammenschluss von Edeka und Tengelmann u.a. Leitlinien für die Auslegung des fusionskontrollrechtlichen Vollzugsverbots in § 41 Abs. 1 GWB festgelegt.
Neben dem Kaufvertrag wurde zwischen Edeka und Tengelmann ein Rahmenvertrag geschlossen, der ‑ auch bereits für die Zeit bis zum Abschluss des Fusionskontrollverfahrens ‑ Regelungen u. a. über den Einkauf von Waren durch Tengelmann über Edeka-Gesellschaften enthielt. Das Bundeskartellamt erließ im laufenden Verfahren eine bis zum Abschluss des Fusionskontrollverfahrens befristete einstweilige Anordnung, mit der u.a. die Durchführung der im Rahmenvertrag vorgesehenen Bündelung der Warenbeschaffung untersagt wurde. Es sah in der vereinbarten Bündelung der Warenbeschaffung einen Verstoß gegen das Vollzugsverbot des § 41 Abs. 1 S. 1 GWB. Die Beteiligten beantragten die Feststellung der Rechtswidrigkeit dieser einstweiligen Anordnung. Das OLG Düsseldorf gab den Beschwerdeführern Recht. Zwar sah es in der Absprache zur Warenbeschaffung ebenso wie das Bundeskartellamt einen Verstoß gegen das Vollzugsverbot. Aus Sicht des OLG Düsseldorf fehlte es aber an dem für den Erlass einer einstweiligen Anordnung erforderlichen Anordnungsgrund.
Das OLG Düsseldorf setzt sich in seinen Entscheidungsgründen mit der bisher in der europäischen und deutschen Rechtsprechung offen gebliebenen Frage auseinander, ob bloße "Vorfeld-Maßnahmen", die weder selbst die Voraussetzungen eines Zusammenschlusstatbestandes erfüllen, noch Teil eines aus mehreren Teilakten bestehenden Zusammenschlusses sind, dem kartellrechtlichen Vollzugsverbot unterliegen. Während in der Literatur solche Vorbereitungshandlungen nicht als Verstoß gegen das Vollzugsverbot angesehen werden, hatte das Bundeskartellamt in der angefochtenen Entscheidung die gegenteilige Auffassung vertreten. Ausreichend sei, dass Vorbereitungshandlungen (also Planungen und Vorbereitungen der künftigen Integration des Zielunternehmens oder rein schuldrechtliche Vertragsbeziehungen) durchgeführt werden, die als Teil eines Gesamtplans auf die Verwirklichung eines formellen Zusammenschlusstatbestandes „zusteuern“ und bereits im Vorfeld des Zusammenschlusses nachteilige wettbewerbliche Wirkungen auslösen, die sich nachträglich nicht wieder vollständig aus der Welt schaffen lassen.
Das OLG Düsseldorf hat diese Rechtsauffassung des Bundeskartellamts abgelehnt. Es sei erforderlich aber auch ausreichend für einen Verstoß gegen das Vollzugsverbot, dass der Zusammenschluss rechtlich oder tatsächlich zumindest zu einem Teil vollzogen ist, ohne dass der Teilakt selbst einen Zusammenschlusstatbestand erfüllen muss. Der Begriff des Vollzugs sei in § 41 Abs. 1 GWB auf den Zusammenschluss und damit auf die Zusammenschlusstatbestände des § 37 Abs. 1 GWB bezogen. Auf den schuldrechtlichen Vertrag, der dem jeweiligen Erwerbsvorgang zugrunde liegt, beziehe sich das Vollzugsverbot nicht. Maßnahmen zur Umsetzung des betreffenden Vertrags könnten daher, wenn sie selbst nicht Teil des Erwerbsvorganges nach § 37 Abs. 1 GWB sind, nicht ohne weiteres als Vollzugsmaßnahme im Sinne von § 41 Abs. 1 GWB angesehen werden. Maßnahmen, die die spätere Durchführung des Zusammenschlusses lediglich vorbereiten und nicht selbst bewirken, dass (ein Teil der) Vermögensgegenstände oder Gesellschaftsanteile auf das Erwerbsunternehmen übertragen wird oder Möglichkeiten für den Erwerber geschaffen werden, auf strategische Entscheidungen des Zielunternehmens Einfluss zu nehmen, erzeugten im Übrigen keine marktstrukturellen Wirkungen, deren Entstehen § 36 GWB endgültig und § 41 Abs. 1 GWB für die Dauer des Fusionskontrollverfahrens verhindern wolle. Es entstehe nicht der von § 36 GWB als kritisch angesehene Zuwachs von Marktmacht durch einen Zusammenschluss, er bereite einen solchen nur vor.
In Anwendung dieser Kriterien kam das OLG Düsseldorf jedoch zum gleichen Ergebnis wie das Bundeskartellamt, da es die Rahmenvereinbarung als einen faktischen Teilvollzug des Zusammenschlussvorhabens ansah. Die im Bereich der gemeinsamen Warenbeschaffung getroffene Vereinbarung führe in weiten Teilen bereits zu einer faktischen Integration der betroffenen Tengelmann-Märkte in den Edeka-Konzern. Für den Beschaffungsmarkt, auf dem sich der Lebensmitteleinzelhandel als Nachfrager und die Hersteller als Anbieter gegenüberstünden, würde Tengelmann als Nachfrager weitestgehend wegfallen. Damit würde faktisch eine Situation geschaffen wie sie eintreten würde, wenn Tengelmann und Edeka den Zusammenschluss schon vollzogen und die Geschäfte von Tengelmann in das Erwerbsunternehmen integriert worden wären.
Im Ergebnis gab das OLG Düsseldorf jedoch dem Antrag der Beschwerdeführer EDEKA und Tengelmann statt, da das Bundeskartellamt es versäumt hatte, den Anordnungsgrund ausreichend darzulegen. Das Bundeskartellamt hatte sich nur mit den wettbewerblich nachteiligen Wirkungen befasst, die eine Übertragung der Beschaffung auf EDEKA nach sich ziehen würde. Es fehlten aber nach Überzeugung des OLG Düsseldorf Ausführungen dazu, ob irreparable Nachteile oder schwere Schäden drohten, die im Interesse des Gemeinwohls abzuwenden seien, so dass ein über das öffentliche Interesse an der Sicherung oder Vermeidung eines späteren Entflechtungsverfahren hinausgehendes besonderes öffentliche Interesse vorliege.
Überprüfung von Hauptversammlungsbeschlüssen einer AG
OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 19. Mai 2015 – 5 U 177/14
Die Beklagte war eine AG, an der der Kläger, der gleichzeitig auch Vorstandsmitglied der Beklagten war, sowie eine weitere AG beteiligt waren. Die letztgenannte AG sowie der Kläger vereinbarten, dass der Kläger die Aktien der AG an der Beklagten, die diese ihm übertragen hatte, für diese treuhänderisch halten sollte. Es ist zwischen der treugebenden AG sowie dem Kläger allerdings streitig, ob dieses Treuhandverhältnis auch nach Umwandlung der ursprünglichen Namensaktien in Inhaberaktien weiter Bestand hatte. Nachdem das zuständige Amtsgericht Frankfurt am Main die AG gemäß § 122 Abs. 3 AktG zur Einberufung einer Hauptversammlung ermächtigt hatte, wählte die Hauptversammlung der Beklagten entsprechend den Vorschlägen der einberufenden AG einzelne Aufsichtsmitglieder ab und wählte neue Mitglieder. Der neue Aufsichtsrat berief daraufhin den Kläger als Vorstand ab. Der Kläger erhob Beschlussmängelklage gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung. Das LG Frankfurt am Main wies die Klage in erster Instanz ab.
Das OLG Frankfurt am Main wies in vorliegender Entscheidung auch die Berufung als unbegründet zurück; die Hauptversammlungsbeschlüsse seien nicht nichtig. Insbesondere verneinte das OLG Frankfurt am Main einen Einberufungsmangel nach § 121 Abs. 3 S. 1 AktG. Der Kläger könne sich nicht darauf berufen, dass die AG nicht (Minderheits-)Aktionärin der Beklagten und deshalb nicht befugt (§ 121 Abs. 2 S. 3 AktG) gewesen sei, mit gerichtlicher Ermächtigung (§ 122 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 S. 1 AktG) die Hauptversammlung einzuberufen. Daher könne die zwischen den Parteien streitige Frage offen bleiben, ob und gegebenenfalls auf welche Weise die AG zeitlich nach der Übertragung der von ihr gehaltenen Aktien auf den Kläger und Abschluss eines Treuhandvertrages wieder Inhaber der anschließend in Inhaberaktien umgewandelten Aktien der Beklagten geworden ist. Entscheidend sei allein, dass die AG durch gerichtlichen Beschluss ermächtigt worden ist (§ 122 Abs. 3 S. 1 bis 3 AktG), die Hauptversammlung einzuberufen. Die Aktionärsstellung und das maßgebliche Quorum sei vom für die Ermächtigung zuständigen Amtsgericht des Gesellschaftssitzes als Voraussetzung des Ermächtigungsverlangens zu prüfen. Ob die Ermächtigung rechtmäßig war, sei im vorliegenden Verfahren hingegen nicht zu entscheiden. Denn die Rechtmäßigkeit der Ermächtigung sei nach der Beschlussfassung auf einer satzungs- und gesetzesmäßig einberufenen Hauptversammlung ohne Bedeutung. Wegen der Gestaltungswirkung der gerichtlichen Ermächtigung könne die Anfechtung des gefassten Beschlusses nicht darauf gestützt werden, dass die Ermächtigung nicht hätte erteilt werden dürfen. Deren Wirksamkeit ist vielmehr im Verfahren nach § 122 Abs. 3 AktG zu überprüfen.
Auch eine Nichtigkeit der Beschlüsse wegen eines Bekanntmachungsmangels, weil die Tagesordnung vorgeblich nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden ist, scheidet aus Sicht des OLG Frankfurt am Main aus. Zwar enthalte die Bekanntmachung, wenn wie im Streitfall die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern auf der Tagesordnung stehe, nicht die vorgeschriebenen Angaben, nach welchen gesetzlichen Vorschriften sich der Aufsichtsrat zusammensetze, und ob die Hauptversammlung an Wahlvorschläge gebunden sei (§ 124 Abs. 2 S. 1 AktG). Das führe aber nicht zur Anfechtbarkeit der gefassten Beschlüsse. Die Anfechtbarkeit wegen eines Bekanntmachungsfehlers setze vielmehr voraus, dass dieser Fehler im Einzelfall die für eine sachgerechte Meinungsbildung der Aktionäre erforderliche Relevanz besitze. Davon sei bei einer unterbliebenen Angabe der Zusammensetzung des Aufsichtsrats und zur Bindung an Wahlvorschläge nicht auszugehen, da dieses Unterlassen regelmäßig nicht dazu führe, dass ein Aktionär vom Erscheinen abgehalten werde.
Ein Bekanntmachungsverstoß sei auch nicht mit Rücksicht darauf gegeben, dass letztlich andere Personen als Aufsichtsratsmitglieder abberufen und bestellt wurden, als die Personen, die in der bekannt gemachten Tagesordnung vorgesehen waren. Bei Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern zählen aus Sicht des OLG Frankfurt am Main alternative Personalvorschläge immer zum bekanntmachungsfreien Bereich. Dies gelte spiegelbildlich auch für die Frage der Abberufung.
Individuelles Gesellschafter-Sonderrecht auf Zustimmung im Gesellschaftsvertrag einer GmbH
OLG Hamm, Urteil vom 21. Dezember 2015 – 8 U 67/15
Der Kläger war gemeinsam mit zwei anderen Personen Gesellschafter der beklagten GmbH. Die beiden weiteren Personen waren auch Geschäftsführer der GmbH. Der Gesellschaftsvertrag der GmbH sah vor, dass für bestimmte Rechtsgeschäfte (u.a. Abschluss von Anstellungsverträgen mit einem Jahresbruttogehalt von mehr als EUR 30.000) die Zustimmung aller Gesellschafter einzuholen ist. Nachdem die Geschäftsführer der Beklagten zu einer Gesellschafterversammlung eingeladen hatten, erteilte der Kläger den beiden anderen Gesellschaftern eine Stimmrechtsvollmacht mit der Weisung, hinsichtlich sämtlicher Beschlussanträge mit „Nein“ zu stimmen. In der Gesellschafterversammlung fassten die beiden Gesellschafter in Abwesenheit des Klägers Beschlüsse u.a. zur Anhebung der oben genannten Grenze für die Zustimmungspflicht zum Abschluss von Anstellungsverträgen auf ein Jahresbruttogehalt von EUR 75.000, wobei beide nicht von der Stimmrechtsvollmacht des Klägers Gebrauch machten. Der Kläger hält den vorgenannten Beschluss für unwirksam.
Das OLG Hamm gab ihm Recht. Der Beschluss habe einen satzungsändernden Beschluss dargestellt, der gemäß § 53 Abs. 2 S. 1 GmbHG grundsätzlich der Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen bedürft hätte. Durch die Satzung könne allerdings auch Einstimmigkeit aller erschienenen oder überhaupt aller Gesellschafter vorgeschrieben werden. Vorliegend sei im Hinblick auf die Regelung im Gesellschaftsvertrag die Zustimmung aller Gesellschafter für die Satzungsänderung erforderlich. Denn wenn nach der Satzung für bestimmte nicht satzungsändernde Gesellschafterbeschlüsse besondere Mehrheiten erforderlich sind, sei im Regelfall davon auszugehen, dass auch die Änderung der betreffenden Satzungsbestimmung nur mit der entsprechenden Mehrheit erfolgen könne. Andernfalls könnte das besondere Mehrheitserfordernis leicht dadurch unterlaufen werden, dass die betreffende Satzungsbestimmung mit der gesetzlich vorgesehenen 3/4-Mehrheit geändert werde. Dies gelte insbesondere dann, wenn nach der Satzung für bestimmte Maßnahmen die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich ist. Eine solche Satzungsregelung sei regelmäßig dahin auszulegen, dass allen Gesellschaftern ein individuelles Sonderrecht eingeräumt werde, welches nicht durch Mehrheitsentscheidung beseitigt werden könne. Die beschriebene Regelung in der Satzung sei hinsichtlich des Zustimmungserfordernisses dahin auszulegen, dass der jeweilige Beschluss nicht von einer Universalversammlung einstimmig gefasst werden müsse, sondern die zur Versammlung nicht erschienenen und auch nicht vertretenen Gesellschafter dem Beschluss vorher oder nachher zustimmen könnten.
Der Kläger habe aber bereits im Vorfeld der Gesellschafterversammlung im Rahmen der Erteilung der Stimmrechtsvollmacht deutlich gemacht, dass er die beabsichtigte Satzungsänderung ablehne. Die fehlende Zustimmung des Klägers zum Beschluss habe die Unwirksamkeit des Beschlusses zur Folge.
Ferner stellte das OLG Hamm fest, dass die Geltendmachung der Unwirksamkeit eines Gesellschafterbeschlusses im Wege der allgemeinen Feststellungsklage nach § 256 ZPO erfolgt. Diese sei nicht fristgebunden. Dies folge daraus, dass unwirksame Beschlüsse ‑ ebenso wie nichtige Beschlüsse ‑ grundsätzlich keine Rechtswirkungen entfalten, während anfechtbare Beschlüsse bis zu ihrer Aufhebung wirksam sind.
Abschließend stellte das OLG Hamm fest, dass eine Klage auf Anfechtung eines Gesellschafterbeschlusses bei Fehlen einer entsprechenden Satzungsregelung mit aller dem klagenden Gesellschafter zumutbaren Beschleunigung erhoben werden muss, wobei die Monatsfrist des § 246 Abs. 1 AktG als Maßstab gilt. Die streitige Frage, zu welchem Zeitpunkt die Anfechtungsfrist beginnt (mit Beschlussfassung oder mit Kenntnis von der Beschlussfassung) hat das OLG Hamm offengelassen. Die Anfechtungsfrist beginne bei in Abwesenheit des klagenden Gesellschafters gefassten Beschlüssen, die ihm nicht zeitnah mitgeteilt werden, spätestens nach Ablauf einer Erkundigungsfrist von ca. zwei Wochen. Dies gelte jedenfalls dann, wenn der Gesellschafter Kenntnis von der Versammlung und ihrer Tagesordnung hatte, wovon das Gericht im vorliegenden Fall ausgegangen war.
Beurkundung einer GmbH-Gründung durch einen Notar aus dem Kanton Bern
AG Charlottenburg, Beschluss vom 22. Januar 2016 – 99 AR 9466/15
Das AG Charlottenburg verweigerte in dieser Handelsregistersache die Eintragung einer GmbH, deren Gründung vor einem Notar aus dem Kanton Bern beurkundet worden war, da es die Beurkundung der GmbH-Gründung durch einen Schweizer Notar als nicht ausreichend erachtete, um die Form des § 2 Abs. 1 S. 1 GmbHG zu wahren. Dies gilt aus Sicht des AG Charlottenburg insbesondere für die Beurkundung durch einen Notar des Schweizer Kantons Bern, da das im Kanton Bern zu beachtende Beurkundungsverfahren derart von deutschen Standards abweiche, dass nicht von einer Gleichwertigkeit der Beurkundung gesprochen werden könne.
Eine Beurkundung durch einen ausländischen Notar sei der Beurkundung durch einen deutschen Notar gleichwertig, wenn (i) die ausländische Urkundsperson für die Errichtung der Urkunde ein Verfahrensrecht zu beachten hat, das den tragenden Grundsätzen des deutschen Beurkundungsrechts entspricht und (ii) die ausländische Urkundsperson nach Vorbildung und Stellung im Rechtsleben eine der Tätigkeit des deutschen Notars entsprechende Funktion ausübt. Eine Gleichwertigkeit des Verfahrensrechts sei vorliegend aber zu verneinen. Dabei sei zu beachten, dass bei der Gründung einer GmbH Willenserklärungen zu beurkunden seien und damit in Deutschland das Verfahren nach §§ 8 ff. BeurkG einzuhalten sei. Nach der Berner Notariatsverordnung (NV) müssten Anlagen gar nicht und die Urkunde nur insoweit vorgelesen werden, als sie Willenserklärungen enthält. Im deutschen Recht dagegen müsse gemäß § 13 BeurkG die gesamte Niederschrift und nicht nur die beurkundeten Erklärungen der Beteiligten vorgelesen werden. Ebenso seien in Deutschland auch die einen Teil der notariellen Niederschrift bildenden Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 1 S. 2 BeurkG zu verlesen. Eine Verletzung der Verlesungspflicht führe zur Nichtigkeit der Beurkundung. Das Verlesen der Urkunde sei im Sinne der Gleichwertigkeits-Rechtsprechung des BGH als tragender Grundsatz des deutschen Beurkundungsrechts anzusehen. Denn gerade das Verlesen sei das zwingende Unterscheidungsmerkmal zur bloßen Beglaubigung. Da dieser Grundsatz im notariellen Verfahrensrecht des Kantons Bern nicht gleichwertig gewahrt sei, ergebe sich bereits aus diesen Gründen die Formnichtigkeit der Gründung der Gesellschaft. Daran ändere auch eine freiwillige, gleichsam „überobligatorische“ Anwendung des höheren (deutschen) Standards durch den ausländischen Notar nichts: Es komme abstrakt darauf an, dass der ausländische Notar nach der für ihn geltenden Notariatsverfassung ein gleichwertiges Verfahren einhalten muss. Jede andere Handhabung würde zu einer Einzelfallprüfung und damit zu einer großen Rechtsunsicherheit führen. Gleichwertig sei nicht eine einzelne Beurkundung, sondern die Beurkundung durch die Notare eines bestimmten Staates.
Hinzu kommt aus Sicht des AG Charlottenburg, dass in der neueren Rechtsprechung des BGH der Zweck der notariellen Beurkundung des Gesellschaftsvertrages (auch) in „Beweissicherungs- und damit Rechtssicherheitsgründen” sowie einer „materiellen Richtigkeitsgewähr” gesehen wird, und die notarielle Beurkundung eine „Prüfungs- und Betreuungsfunktion” gewährleistet. Dem sei jedenfalls zuzustimmen, wenn die Wirkungen der beurkundeten Erklärungen über den Kreis der unmittelbar Beteiligten hinausreichen und auch für Dritte Geltung haben oder erlangen könnten, also insbesondere bei Akten, die die Verfassung der Gesellschaft betreffen, wie es die Gründung einer GmbH sei. In diesen Fällen habe der Gesetzgeber nicht nur die schwächere Form der notariellen Beglaubigung, sondern ausdrücklich die notarielle Beurkundung angeordnet. Grund dieser Anordnung sei, dass eben nicht nur sichergestellt werden soll, dass die Identität der Erklärenden zweifelsfrei feststeht, sondern dass die Urkundsperson auch sachlich zu dem Inhalt der beurkundeten Erklärungen Stellung nehmen soll, und diese Stellungnahme ‑ im Gegensatz zu den beratenden Rechtsanwälten ‑ von neutraler Warte aus erfolgt. Ein ausländischer Notar könne aber diese vom Gesetzgeber durch Anordnung der notariellen Beurkundung bezweckte materielle Richtigkeitsgewähr gerade nicht gewährleisten.
Schließlich komme hinzu, dass regelmäßig nur ein deutscher Notar den Melde- und Kontrollpflichten unterliegt wie z. B. § 54 EStDV, der dem (deutschen) Notar bei der Gründung von Kapitalgesellschaften aufgibt, dem Finanzamt beglaubigte Abschriften der Gründungsurkunde zu übersenden. Auch aus diesem Grund sei das Beurkundungsverfahren in der Schweiz dem deutschen nicht gleichwertig.
Aktienbindungsvertrag kein sonstiges Instrument im Sinne des § 25a Abs. 1 a.F. WpHG
VG Frankfurt am Main, Urteil vom 4. November 2015 – 7 K 4703/15
Die Klägerin hält mit weiteren 149 Familienangehörigen, Nachfahren und von diesen gegründeten Stiftungen und Gesellschaften Stammaktien eines Unternehmens. Die Familienaktionäre hatten sich in einem Aktienbindungsvertrag zusammengeschlossen, der auf eine einheitliche Stimmrechtsausübung abzielte und darüber hinaus Regelungen in Bezug auf die Übertragung von Stammaktien innerhalb der Familie bzw. der Familienstämme traf. Der von den Familienaktionären gehaltene Anteil der Stimmrechte am Unternehmen betrug ca. 61 %. Im vorliegenden Verfahren war zu klären, ob die Parteien des Aktienbindungsvertrags wegen der im Vertrag getroffenen Regelungen für die Übertragung und den Erwerb von Aktien verpflichtet waren, Stimmrechtsmitteilungen auf der Grundlage des zum damaligen Zeitpunkt neu eingeführten § 25a Abs. 1 a.F. (vor Inkrafttreten des Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie-Umsetzungsgesetzes), § 41 Abs. 4d WpHG abzugeben. Diese Vorschrift war geschaffen worden, um das mehrfach bei versuchten (Porsche/VW) und erfolgreichen (Schaeffler/Continental) Unternehmensübernahmen praktizierte „Anschleichen“ durch so genannte cash settled swaps unmöglich zu machen. Der Gesetzgeber sah sich der Kritik ausgesetzt, in seinem Bemühen um einen umfassenden Ansatz einen viel zu schwammigen Wortlaut gewählt zu haben, der unbeabsichtigte Weiterungen zur Folge haben könne.
Das VG Frankfurt am Main verneinte eine Verpflichtung der Klägerin zur Abgabe einer Stimmrechtsmitteilung nach § 25a Abs. 1 a.F., 41 Abs. 4d WpHG. Der Aktienbindungsvertrag sei nicht als sonstiges Instrument im Sinne des § 25a Abs. 1 WpHG a.F. anzusehen. Der Tatbestand des § 25a Abs. 1 WpHG a.F. sei grundsätzlich weit gefasst. Während § 25 Abs. 1 WpHG a.F. Meldepflichten in Bezug auf Finanzinstrumente begründe, die dem jeweiligen Inhaber das Recht verleihen, die in der Vorschrift näher bezeichneten Aktien zu erwerben (in der Regel ist dies ein unmittelbarer Anspruch auf Übereignung der Aktien), begründe § 25a Abs. 1 WpHG a.F. ergänzend eine Mitteilungspflicht auch dann, wenn der Inhaber des Finanzinstruments oder des sonstigen Instruments zwar kein Recht auf den Erwerb hat, aber die Ausgestaltung des Finanzinstruments oder des sonstigen Instruments es ermöglicht, die in der Vorschrift bezeichneten Aktien zu erwerben. Zwar seien die Vorschriften des Aktienbindungsvertrags über die Übertragung und den Erwerb von Aktien zwischen Familienangehörigen grundsätzlich geeignet, den Erwerb von Aktien im Sinne der Vorschrift zu ermöglichen. Die weiteren Voraussetzungen für die Qualifikation des Aktienbindungsvertrags als ein sonstiges Instrument im Sinne des § 25a Abs. 1 WpHG a.F. sind aus Sicht des VG Frankfurt am Main jedoch nicht erfüllt:
Bereits im Wortlaut des § 25a Abs. 1 S. 1 WpHG a.F. komme zum Ausdruck, dass ein „sonstiges Instrument“ nur vorliegen könne, wenn es „aufgrund seiner Ausgestaltung“ dem jeweiligen Inhaber oder Halter möglich sei, die in der Vorschrift bezeichneten Aktien zu erwerben. Es müsse sich also einerseits aus wirtschaftlichen Gründen die konkrete Möglichkeit zum Erwerb ergeben, weil die Gegenseite ein eigenständiges wirtschaftliches Interesse an der Lieferung der Aktien hat. Darüber hinaus müsse sich andererseits die Möglichkeit des Erwerbs der Aktien unmittelbar aus der Ausgestaltung des Instruments selbst ergeben. Dies sei so zu verstehen, dass das Instrument selbst von vornherein und seiner Zweckbestimmung nach auf den (gewissermaßen zwangsläufigen und den Gesichtspunkten der wirtschaftlichen Logik folgenden) Erwerb von Aktien gerichtet sein müsse. Folglich könne es für die Qualifikation des Vertrags als „sonstiges Instrument“ nicht schon genügen, dass der Vertrag eine bloße Möglichkeit zum Aktienerwerb bietet. Zur Ermöglichung eines Aktienerwerbs müsse vielmehr hinzukommen, dass dieser Erwerb gleichsam zwangsläufige Folge des Beitritts zum Aktienbindungsvertrag (mit anderen Worten: dass der Aktienbindungsvertrag auf solche Erwerbsvorgänge angelegt) und durch eine „wirtschaftliche Logik“ bedingt sei. Die letztere Voraussetzung solle nach Auffassung des Gesetzgebers nur dann erfüllt sein, wenn zugleich ein unmittelbarer „Bezug zu den betroffenen Aktien“ gegeben ist. Ein solcher Bezug folge nach der ausdrücklichen Formulierung in der Gesetzesbegründung daraus, dass das Instrument selbst in seinem Bestehen oder im Hinblick auf seine Renditechancen von der Kursentwicklung der jeweiligen Aktie abhängig ist. Der Aktienbindungsvertrag sei aber schon nicht darauf gerichtet, den Vertragsparteien Renditechancen einzuräumen. Der Schwerpunkt der vertraglichen Regelungen liege nicht etwa darauf, den Parteien des Aktienbindungsvertrags eine möglichst große Rendite zu verschaffen oder im Hinblick auf die Kursschwankungen der Unternehmensaktie weitere Aktienerwerbsmöglichkeiten einzuräumen, wie dies bei einem klassischen Finanzinstrument der Fall wäre. Vielmehr regele er auf gesellschaftsrechtlicher Basis primär das Verhältnis der Familienaktionäre untereinander, insbesondere im Hinblick auf die Ausübung der mit dem Halten der Stammaktien verbundenen Stimmrechte. Wer dem Vertrag beitrete, tue dies nicht aus Renditeinteressen. Diese würden vielmehr in der Regel ‑ wenn die Aktien nicht im Wege der Erbfolge oder Schenkung übertragen wurden ‑ dem vorausgegangenen Aktienerwerb selbst zugrunde liegen. Soweit der Vertrag Regelungen für die Übertragung und den Erwerb von Aktien treffe, stünden dabei auch nicht die dargelegten Gesichtspunkte der „wirtschaftlichen Logik“ im Vordergrund, auf die es jedoch für die Zurechnung zu den „sonstigen Instrumenten“ maßgebend ankommt. Vielmehr bezweckten diese Bestimmungen allein, den Einfluss der Familienaktionäre auch im Fall der Übertragung von unter den Aktienbindungsvertrag fallenden Aktien zu sichern.
Der Aktienbindungsvertrag räume auch nicht die Möglichkeit ein, im Sinne eines „Anschleichens“ unbemerkt Stimmrechtspositionen aufzubauen, um das Unternehmen zu übernehmen. Primäre Zielsetzung der gesetzlichen Regelung sei gerade zu verhindern, dass in intransparenter Weise größere Stimmrechtspositionen aufgebaut werden können. Der Aktienbindungsvertrag ermögliche allenfalls die Verlagerung von Stimmrechtspositionen zwischen den Parteien des Vertrags. Ein Aufbau von großen Stimmrechtspositionen allein aufgrund der Ausgestaltung der Übertragungsregelungen im Vertrag erscheine schlechterdings nicht vorstellbar. Damit falle der Vertrag aus der Zwecksetzung des § 25a Abs. 1 WpHG a.F. heraus.
Gesetzgebung
Verschiebung der Anwendung der Finanzmarktrichtlinie MiFID II auf 2018
Die EU Kommission hat in Form einer Änderungsrichtlinie vorgeschlagen, die Anwendung der Mitte 2014 beschlossenen Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID II“) um ein Jahr zu verschieben. Neue Frist wäre dann der 3. Januar 2018. Die EU Kommission will damit der europäischen Finanzmarktaufsicht ESMA sowie den nationalen Behörden und Marktteilnehmern ein Jahr mehr Zeit geben, um insbesondere die technischen Voraussetzungen für die Anwendung des Reformpakets umzusetzen. Die ESMA hatte mitgeteilt, dass eine technische Umsetzung zum ursprünglich geplanten Termin nicht möglich erscheint.
Die Pflicht der Mitgliedstaaten, bis zum 3. Juli 2016 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen und zu veröffentlichen (Artikel 93 Abs. 1 MiFID II), die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen, bleibt nach derzeitigem Stand der Änderungsrichtlinie unberührt. Die EU Finanzminister fordern jedoch mit überwiegender Mehrheit eine Verschiebung auch dieser Frist.
Die MiFID II einschließlich der dazugehörenden Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente („MiFIR“) enthält eine umfassende Reform der geltenden europäischen Finanzmarktregulierung und beinhaltet insbesondere eine Ausweitung von Transparenz- und Anlegerschutzvorschriften, Regeln über die Zulassung von Wertpapierfirmen und die Ausübung ihrer Tätigkeit, den Hochfrequenzhandel sowie über Aufsichts- und Sanktionsbefugnisse, Rohwarenderivate und den Zugang zu Handelsplätzen.
Pressemitteilung der EU Kommission
Möchten Sie diesen Noerr-Newsletter künftig per E-Mail beziehen? Klicken Sie auf der rechten Seite auf 'jetzt anmelden'.
Archiv:
- Corporate-Newsletter Januar 2016
- Corporate-Newsletter Dezember 2015
- Corporate-Newsletter November 2015
- Corporate-Newsletter Oktober 2015
- Corporate-Newsletter September 2015
- Corporate-Newsletter Juli 2015
- Corporate-Newsletter Juni 2015
- Corporate-Newsletter Mai 2015
- Corporate-Newsletter April 2015
- Corporate-Newsletter März 2015
- Corporate-Newsletter Februar 2015
- Corporate-Newsletter Januar 2015