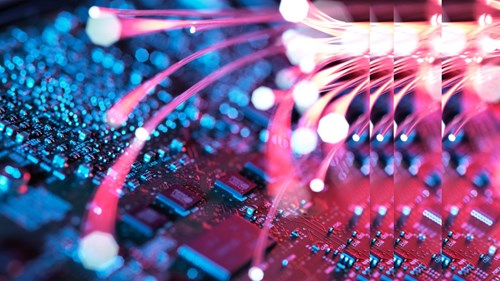Corporate-Newsletter September 2015
In unseren Corporate/M&A-News bereiten wir aktuelle Themen zum Gesellschaftsrecht/M&A prägnant für Sie auf. Wir filtern dazu wesentliche neue Rechtsprechung und Gesetzgebungsvorhaben und fassen diese mit Verlinkungen zusammen. In der aktuellen Ausgabe informieren wir Sie u. a. über folgende Themen:
Rechtsprechung
Fremd-Geschäftsführer einer GmbH als „Arbeitnehmer“ bei Massenentlassung
EuGH, Urteil vom 9. Juli 2015 – C-229/14
Nach deutschem Recht gelten Geschäftsführer und Vorstände von Gesellschaften nicht als Arbeitnehmer. Vielmehr sind sie Organe des entsprechenden Unternehmensträgers und daher einem Arbeitgeber gleichgestellt. Aus diesem Grund ordnet § 17 Abs. 5 Nr. 1 KSchG im Falle von Massenentlassungen an, dass Organmitglieder bei der Berechnung des Schwellenwerts, bei dessen Erreichen Arbeitgeber zu einer Massenentlassungsanzeige verpflichtet sind, nicht berücksichtigt werden. Der EuGH hat nun jedoch entschieden, dass unter Berücksichtigung europäischen Rechts jedenfalls Geschäftsführer einer GmbH ohne Beteiligung an der Gesellschaft bei der Ermittlung der Schwellenwerte als Arbeitnehmer zu berücksichtigen sind und § 17 KSchG insofern als europarechtswidrig anzusehen ist.
Der EuGH stellt klar, dass der Begriff „Arbeitnehmer“ in Artikel 1 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 98/59 nicht durch Verweisung auf die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten definiert werden dürfe, sondern innerhalb der Unionsrechtsordnung autonom und einheitlich ausgelegt werden müsse. Wesentliches Merkmal des unionsrechtlichen Arbeitsnehmerbegriffs sei, dass eine Person während einer bestimmten Zeit für eine andere nach deren Weisung Leistungen erbringt, für die sie als Gegenleistung eine Vergütung erhält. Sei eine Person Mitglied des Leitungsorgans einer Kapitalgesellschaft, schließe dies nicht per se aus, dass sich diese Person in einem Unterordnungsverhältnis gegenüber der betreffenden Gesellschaft befinde und damit als „Arbeitnehmer“ zu qualifizieren sei. Zu prüfen seien vielmehr die konkreten Bedingungen, unter denen das Mitglied des Leitungsorgans bestellt wurde, die Art der ihm übertragenen Aufgaben, der Rahmen, in dem diese Aufgaben ausgeführt werden, der Umfang der Befugnisse des Organmitglieds und die Kontrolle, der es innerhalb der Gesellschaft unterliegt, sowie die Umstände, unter denen es abberufen werden könne.
Die Leitungsorgane einer GmbH, die weisungsabhängig einer vergüteten Tätigkeit nachgehen und über keine Sperrminorität verfügen, werden von der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ernannt, die die betreffende Leitungsperson jederzeit gegen ihren Willen abberufen könne. Zudem unterliegen diese Leitungsorgane bei der Ausübung ihrer Tätigkeit der Weisung und Aufsicht der Gesellschafterversammlung sowie den ihr insoweit auferlegten Vorgaben und Beschränkungen. Unter diesen Umständen müsse man davon ausgehen, dass sich ein solches Mitglied der Unternehmensleitung einer derartigen Kapitalgesellschaft – unbeschadet der Tatsache, dass es bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben über einen Ermessensspielraum verfüge, der über den eines Arbeitnehmers im Sinne des deutschen Rechts hinausgehe – zu der Gesellschaft in einem Unterordnungsverhältnis befinde. Außerdem erhalte ein solches Leitungsorgan eine Vergütung für seine Tätigkeit. Es erfülle demnach alle Merkmale des europäischen Arbeitnehmerbegriffs.
Haftung des Geschäftsführers einer insolvenzreifen GmbH bei masseschmälernder Zahlung
BGH, Urteil vom 23. Juni 2015 – II ZR 366/13
Der Kläger des Verfahrens ist Insolvenzverwalter einer GmbH, die Beklagte ist deren Geschäftsführerin. Die insolvente GmbH hatte ein Kontokorrentkonto. Durch Globalzessionsvertrag trat die GmbH der Bank zur Sicherung aller Forderungen aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung sämtliche bestehenden und künftigen Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen gegen Dritte mit wenigen Ausnahmen ab. Mit der Klage verlangt der Kläger von der Beklagten Schadenersatz nach § 64 Abs. 2 GmbHG a.F. (§ 64 S. 1 GmbHG n.F.) in Höhe der Summe der nach Eintritt der Insolvenzreife der GmbH auf dem Kontokorrentkonto gebuchten Eingänge abzüglich der Rücklastschriften.
Der BGH lehnte einen solchen Anspruch ab. Er stellte zunächst klar, dass zwar der Einzug von Forderungen einer insolvenzreifen GmbH auf ein debitorisches Konto grundsätzlich eine masseschmälernde Zahlung im Sinne von § 64 Abs. 2 GmbHG a.F. sein könne, weil dadurch das Aktivvermögen der Gesellschaft zu Gunsten der Bank und zu Lasten der übrigen Gläubiger geschmälert werde. Der Einzug von Forderungen, die an eine Bank zur Sicherheit abgetreten waren, auf ein debitorisches Konto der GmbH und die anschließende Verrechnung mit dem Sollsaldo sei jedoch keine vom GmbH-Geschäftsführer veranlasste masseschmälernde Zahlung, wenn die Sicherungsabtretung vor Insolvenzreife vereinbart worden sei und die Forderung der Gesellschaft entstanden und werthaltig sei.
§ 64 Abs. 2 GmbHG a.F. meine mit „Zahlung“ eine Leistung der Insolvenzschuldnerin, durch welche die den Gläubigern zur Verfügung stehende Vermögensmasse geschmälert werde. Im konkreten Fall sei die Vermögensmasse jedoch nicht geschmälert: Sicherungsabgetretene Forderungen eines Schuldners würden zwar zur Insolvenzmasse im Sinn von § 35 InsO zählen, die der Verwaltungsbefugnis des Insolvenzverwalters unterliegen. Sie stünden aber nicht als freie Masse den Gläubigern zur gleichmäßigen Befriedigung zur Verfügung, sondern nur dem Zessionar (hier also der Bank). Der Zessionar habe ein Absonderungsrecht (§ 51 Nr. 1 InsO). Auch der Insolvenzverwalter müsse nach einer Verwertung den absonderungsberechtigten Gläubiger befriedigen (§ 170 Abs. 1 S. 2 InsO).
Schließlich stellte der BGH klar, dass der GmbH-Geschäftsführer die sicherungsabgetretene Forderung auch nicht durch Einziehung auf ein neu eröffnetes, kreditorisch geführtes Konto bei einer anderen Bank der Einziehung und Verrechnung auf dem debitorischen Konto entziehen musste.
Aufhebung eines Unternehmensvertrags mit GmbH nur zum Geschäftsjahresende
BGH, Urteil vom 16. Juni 2015 – II ZR 384/13
Kläger des Verfahrens ist der Insolvenzverwalter einer GmbH. Diese hatte mit der Beklagten, ihrer als GmbH organisierten damals alleinigen Gesellschafterin, einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Im Rahmen der Veräußerung von Anteilen der Beklagten an der insolventen GmbH vereinbarten die Beklagte und die insolvente GmbH die Aufhebung des Ergebnisabführungsvertrages. Diese wurde jedoch nicht zum Ende des Geschäftsjahres, sondern mit sofortiger Wirkung, zum Ende des Monats April, vereinbart. Zu Ende April wies die insolvente GmbH einen höheren Jahresfehlbetrag auf als zum Ende des Jahres. Der klagende Insolvenzverwalter machte im vorliegenden Verfahren Verlustausgleich gemäß § 302 Abs. 1 AktG in Höhe des (höheren) Jahresfehlbetrages zum Ende des vereinbarten Aufhebungszeitpunkts geltend.
Der BGH gab dem Insolvenzverwalter nicht Recht und begründete dies damit, dass der Ergebnisabführungsvertrag nicht während des laufenden Geschäftsjahrs beendet worden sei. Entsprechend § 296 Abs. 1 S. 1 AktG könne ein Unternehmensvertrag mit einer abhängigen GmbH vielmehr nur zum Ende des Geschäftsjahrs oder des sonst vertraglich bestimmten Abrechnungszeitraums aufgehoben werden. Die Vorschriften des AktG über die Begründung und die Beendigung eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit einer abhängigen AG seien grundsätzlich auf Unternehmensverträge mit einer abhängigen GmbH entsprechend anzuwenden, soweit der Schutzzweck der Vorschriften bei einer abhängigen GmbH gleichermaßen zutreffe und sie nicht auf Unterschieden der Binnenverfassung zwischen der AG und der GmbH beruhen. Der Schutzzweck von § 296 Abs. 1 S. 1 AktG treffe auf die GmbH in gleicher Weise zu wie auf eine AG. Ein Unternehmensvertrag könne im Interesse der Rechtssicherheit und -klarheit nur zum Ende des Geschäftsjahres oder des sonst vertraglich bestimmten Abrechnungszeitraums beendet werden. Dass in anderen Fällen einer unterjährigen Vertragsbeendigung etwa durch Insolvenz oder Kündigung eine Stichtagsbilanz für die Berechnung der Ansprüche der Gesellschafter und zum Schutz der Gläubiger genügt, stehe dem nicht entgegen. In diesen Fällen überwiege das Interesse an einer unterjährigen Beendigung des Unternehmensvertrages, so dass die damit verbundenen Nachteile hinzunehmen seien. Dagegen vereinfache es die Abrechnung sowohl etwaiger Ansprüche der Minderheitsgesellschafter wie auch der Ergebnisabführung, wenn die ohnehin zum Ende des Geschäftsjahres oder eines vereinbarten Abrechnungszeitraums zu erstellende Bilanz zugrunde gelegt werden könne. Da die Bilanz zum Ende des Geschäftsjahres regelmäßig geprüft werde, sei die Gefahr einer Manipulation geringer als bei einer unterjährigen Zwischenrechnung. Gleiches gelte für die Gefahr, dass eine Abrechnung ganz unterlassen werde. Die in § 296 Abs. 1 S. 1 AktG zum Ausdruck kommende Wertentscheidung des Gesetzgebers sei zu beachten, auch soweit es Unternehmensverträge mit einer GmbH betreffe. Die Beeinträchtigung der Vertragsfreiheit durch die entsprechende Anwendung des § 296 Abs. 1 S. 1 AktG wiege auch nicht besonders schwer, weil die Obergesellschaft regelmäßig als Mehrheits- oder Alleingesellschafter der abhängigen GmbH ein Rumpfgeschäftsjahr beschließen könne.
Der BGH hielt es für möglich, die Aufhebungserklärung der Beklagten angesichts einer nicht möglichen Aufhebung zum vereinbarten Zeitpunkt in eine Kündigungserklärung aus wichtigem Grund umzudeuten. Dabei konnte es dahinstehen, ob die Veräußerung der Beteiligung durch die Obergesellschaft ein wichtiger Grund für die fristlose Kündigung des Ergebnisabführungsvertrags entsprechend § 297 Abs. 1 S. 1 AktG durch die Obergesellschaft sein kann. Ein wichtiger Grund liegt aus Sicht des BGH nur vor, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Unternehmensvertrags bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Selbst wenn die Beteiligungsveräußerung als wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung grundsätzlich in Betracht käme, würde eine Umdeutung hier daran scheitern, dass nicht ersichtlich gewesen sei, dass es der Beklagten im April unzumutbar gewesen sei, den Ergebnisabführungsvertrag bis zum Jahresende fortzuführen. Die Beteiligung an der Schuldnerin war an eine Gesellschaft veräußert worden, die zum Zeitpunkt der Aufhebungsvereinbarung noch zum Konzern gehörte.
Gesellschafterliche Treuepflicht bei „Sanieren oder Ausscheiden“
BGH, Urteil vom 9. Juni 2015 – II ZR 420/13
In Fortführung seiner „Sanieren oder Ausscheiden“-Rechtsprechung (Urteil vom 19. Oktober 2009 – II ZR 240/08 und Urteil vom 25. Januar 2011 – II ZR 122/09) hat der BGH nun entschieden, dass der Gesellschaftsvertrag zwar die Grundlage der gesellschafterlichen Treuepflicht bildet und damit auch deren Inhalt und Umfang bestimmt. Der einzelne Gesellschafter sei also nur insoweit verpflichtet, wie er es im Gesellschaftsvertrag versprochen habe. Der Gesellschaftsvertrag einer Publikumspersonengesellschaft müsse aber für eine Zustimmungspflicht des Gesellschafters zu seinem Ausscheiden aus gesellschafterlicher Treuepflicht in besonders gelagerten Ausnahmefällen keine ausdrückliche Regelung enthalten, da diese Treuepflicht jedem Gesellschaftsverhältnis ohne ausdrückliche Regelung immanent sei.
Ein Gesellschaftsvertrag könne allerdings diese Treuepflicht ausdrücklich oder im Wege der Auslegung zu konkretisierende Regelungen enthalten, die insbesondere aus der Treuepflicht folgende Zustimmungspflichten für bestimmte Sachverhalte einschränken oder an weitere Voraussetzungen knüpfen. Enthalte ein Gesellschaftsvertrag eine solche die Zustimmungspflicht einschränkende oder modifizierende Regelung, dürften die Mitgesellschafter aus Sicht des BGH nicht ohne weiteres darauf vertrauen, dass sie einen Gesellschafter ohne seine Zustimmung ausschließen können. Erlaube das eingegangene Gesellschaftsverhältnis keine berechtigte Erwartungshaltung gegenüber einzelnen Gesellschaftern, bestehe auch keine Treuepflicht, diese zu erfüllen.
Teilbarkeit eines Hauptversammlungsprotokolls bei nichtbörsennotierter AG
BGH, Urteile vom 19. Mai 2015 – II ZR 176/14 und II ZR 181/14
In dem ersten Verfahren fasste die Hauptversammlung einer beklagten nichtbörsennotierten Aktiengesellschaft Beschlüsse über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Änderung der Satzung, über die Entlastung des Vorstands für das vergangene Geschäftsjahr, über die Entlastung des Aufsichtsrats, über die Wahl des Abschlussprüfers und über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien. Bis zur Beschlussfassung über die Änderung der Satzung war ein Notar anwesend, fertigte eine Niederschrift an und unterzeichnete sie. Eine weitere Niederschrift über die gesamte Hauptversammlung wurde vom Aufsichtsratsvorsitzenden, der die Versammlung leitete, gefertigt und unterzeichnet. Im zweiten genannten Verfahren fasste die Hauptversammlung Beschlüsse zur Gewinnverwendung, über die Entlastung des Vorstands, über die Wahl des Abschlussprüfers, über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, über den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit einer GmbH als beherrschte Gesellschaft, über die Entlastung des Aufsichtsrats sowie die Neuwahl des Aufsichtsrats. Die Niederschrift über diese Versammlung wurde vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats unterzeichnet. In beiden Verfahren erhob eine Aktionärin Nichtigkeitsklage.
Bislang war streitig, ob bei nichtbörsennotierten Aktiengesellschaften nach § 130 Abs. 1 AktG die gesamte Versammlung von einem Notar protokolliert werden muss, wenn die Hauptversammlung auch nur einen Beschluss fasst, der nach dem Gesetz eine qualifizierte Mehrheit voraussetzt. Der BGH verneinte dies nun. Die formwirksame Protokollierung von Hauptversammlungsbeschlüssen nach § 130 Abs. 1 AktG sei für jeden Beschluss separat zu beurteilen. Niederschriften über eine Hauptversammlung seien grundsätzlich in einen notariell zu protokollierenden und einen privatschriftlichen Teil teilbar.
Hierfür spreche zunächst der Wortlaut des § 130 Abs. 1 AktG. Danach müsse jeder Beschluss durch eine über die Verhandlung aufgenommene Niederschrift beurkundet werden. Die Formulierung, dass „jeder Beschluss“ beurkundet werden müsse, spreche für Teilbarkeit. Dafür spreche auch, dass nach dem Gesetz eine privatschriftliche Niederschrift ausreiche, „soweit“ keine Beschlüsse gefasst würden, für die das Gesetz eine Dreiviertel- oder größere Mehrheit bestimmt. Hätte der Gesetzgeber vorsehen wollen, dass die gesamte Niederschrift zu beurkunden ist, müsste es im Gesetz „sofern“ statt „soweit“ heißen.
Systematisch könne für eine Beschränkung der Pflicht zur notariellen Beurkundung auf die einzelnen Beschlüsse, für die das Gesetz eine Dreiviertel- oder größere Mehrheit bestimmt, angeführt werden, dass § 130 Abs. 1 S. 3 AktG zunächst generell die privatschriftliche Niederschrift erlaube und es sich bei der notariellen Protokollierung von Beschlüssen innerhalb der Regelung des Satzes 3 zur nichtbörsennotierten Aktiengesellschaft um eine Ausnahme handele. § 130 Abs. 5 AktG spreche auch nicht eindeutig dafür, dass die gesamte Hauptversammlung einheitlich beurkundet werden müsse. Zwar sehe Abs. 5 als Regelfall die Einreichung einer öffentlich beglaubigten Abschrift der Niederschrift vor, während nur im Fall des Abs. 1 S. 3 eine vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats unterzeichnete Abschrift genüge. Wenn eine gemischte Protokollierung durch Notar und Aufsichtsratsvorsitzenden möglich sei, ließe sich das aber auch dahin verstehen, dass eine öffentlich beglaubigte Abschrift einzureichen ist, soweit notariell beurkundet ist, und im Übrigen, nämlich für alle Beschlüsse, die von Abs. 1 S. 3 erfasst werden, eine vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats unterzeichnete Abschrift. Dass insgesamt nur eine Abschrift der Niederschrift einzureichen sei, „eine“ also als Zahlwort und nicht als unbestimmter Artikel zu verstehen ist, lasse sich § 130 Abs. 5 AktG nicht entnehmen.
Der Zweck der notariellen Niederschrift, bei Beschlüssen mit qualifizierter Mehrheit für eine erhöhte Rechtssicherheit zu sorgen, sagt aus Sicht des BGH ebenfalls wenig darüber aus, ob eine einheitliche Beurkundung erforderlich ist oder nicht. Es gebe allerdings keinen Grund, auch die „einfachen“ Beschlüsse von der erhöhten Rechtssicherheit der notariellen Niederschrift profitieren zu lassen, nur weil sie in derselben Hauptversammlung gefasst werden.
Im erstgenannten Verfahren äußert sich der BGH zusätzlich zu den Auswirkungen der Nichtigkeit von satzungsändernden Beschlüssen auf andere Beschlüsse der Hauptversammlung. Würden in einem Beschluss mehrere Satzungsänderungen zusammengefasst und sei eine der Satzungsänderungen nichtig, seien entsprechend § 139 BGB die weiteren Satzungsänderungen ebenfalls nichtig, wenn ein innerer Zusammenhang zwischen den Änderungen gegeben sei. Demnach sei der ganze Beschluss nichtig, wenn nicht anzunehmen ist, dass er auch ohne den nichtigen Teil gefasst worden wäre. Insoweit komme es auf den mutmaßlichen Willen der Hauptversammlung an, der grundsätzlich durch Auslegung des Beschlusses zu ermitteln ist.
Ausfallhaftung eines ausgeschiedenen Mitgesellschafters nach Kaduzierung
BGH, Urteil vom 19. Mai 2015 – II ZR 291/14
Der Beklagte war gemeinsam mit einer weiteren Person Gesellschafter der zwischenzeitlich insolventen GmbH. Der Beklagte hatte seine Einlage vollständig geleistet. Der weitere Gesellschafter erbrachte die Einlage lediglich zur Hälfte. Im weiteren Verlauf übertrug der Beklagte seinen Geschäftsanteil an der GmbH auf den weiteren Gesellschafter, dessen ausstehende Einlage auch zum Zeitpunkt der Übertragung weder geleistet noch eingefordert worden war. Nachdem die GmbH insolvent geworden war, verlangte der hier klagende Insolvenzverwalter zunächst erfolglos von dem nunmehr alleinige Gesellschafter die Leistung der noch ausstehenden Einlage. Nachdem dieser die ausstehende Einlage auch nach Aufforderung durch den Insolvenzverwalter nicht leistete, wurde sein Anteil nach § 21 Abs. 2 GmbH kaduziert. Der Insolvenzverwalter macht nun gegen den Beklagten als früheren Gesellschafter die Zahlung der ausstehenden Einlage geltend.
Der BGH verneint jedoch eine Haftung des Beklagten. Der Beklagte haftet demnach weder nach § 22 Abs. 1 GmbHG noch nach § 24 GmbHG für die von seinem ehemaligen Mitgesellschafter nicht erfüllte Einlageverpflichtung. Eine Haftung nach § 22 Abs. GmbHG scheide aus, da der Beklagte in Bezug auf den kaduzierten Geschäftsanteil kein Rechtsvorgänger im Sinne dieser Vorschrift sei. Der Beklagte hafte auch nicht nach § 24 GmbHG, weil er kein „übriger Gesellschafter“ im Sinne dieser Vorschrift sei. Übriger Gesellschafter im Sinne des § 24 GmbHG sei nur derjenige, der im Zeitpunkt der Fälligkeit der betreffenden Stammeinlagerate noch Gesellschafter ist. Mangels Satzungsbestimmung werde der Restbetrag einer Einlageforderung erst mit Beschluss der Gesellschafter und Einforderung durch den Geschäftsführer oder – wie hier – mit Einforderung durch einen etwaigen Insolvenzverwalter fällig. Die Einforderung durch den Insolvenzverwalter erfolgte jedoch erst nach Ausscheiden des Beklagten aus der Gesellschaft.
Der BGH lehnte auch eine Haftung des Beklagten als Rechtsvorgänger in Bezug zu dem von ihm auf den anderen Gesellschafter übertragenen Geschäftsanteil für eine diesen selbst wegen der Kaduzierung seines eigenen Geschäftsanteils treffende Ausfallhaftung nach den §§ 22, 24 GmbHG ab. Der kaduzierte Gesellschafter hafte nach Ansicht des BGH – zusätzlich zu seiner Haftung als mit dem kaduzierten Geschäftsanteil ausgeschlossener Gesellschafter nach § 21 Abs. 3 GmbHG – für die Rückstände auf den kaduzierten Geschäftsanteil nach § 24 GmbHG auch dann, wenn er über einen weiteren Geschäftsanteil neben dem kaduzierten Geschäftsanteil verfügt. Diese den Kaduzierten als Inhaber eines nicht kaduzierten Geschäftsanteils treffende Ausfallhaftung treffe jedoch nicht einen Rechtsvorgänger in Beziehung zu dem nicht kaduzierten Geschäftsanteil. Denn die Aufbringung von Fehlbeträgen nach § 24 GmbHG betreffe keine „nicht erfüllten Einlageverpflichtungen“ im Sinne des § 22 Abs. 1 GmbHG. Eine Kaduzierung wegen der verzögerten Aufbringung von Fehlbeträgen nach § 24 GmbHG finde nicht statt. Die an die Kaduzierung anknüpfende Haftung der Rechtsvorgänger erfasse vielmehr nur diejenige Einlageverpflichtung, derentwegen die Kaduzierung betrieben werden könne.
Eine Ausnahme von dem allgemein anerkannten Grundsatz, dass derjenige Gesellschafter, der vor Fälligkeit der Einlageforderung des Kaduzierten aus der Gesellschaft ausgeschieden ist, nicht nach § 24 GmbHG hafte, sei auch nicht deshalb geboten, weil der Beklagte seinen Geschäftsanteil auf seinen später mit seinem eigenen Geschäftsanteil kaduzierten Mitgesellschafter übertragen hat.
Mit dem Schutzzweck des § 24 GmbHG lasse sich eine Haftung des seinen Geschäftsanteil vor Fälligkeit der Einlageschuld des Mitgesellschafters auf diesen übertragenden Gesellschafters nicht begründen. Die Vorschrift diene dem Schutz der Kapitalaufbringung. Eine weitergehende Ausdehnung der bereits als hart empfundenen Haftung nach § 24 GmbHG sei nicht veranlasst. Die Gefahr, dass sich der Übertragende anderenfalls einer bereits entstandenen aufschiebend bedingten Zahlungspflicht gezielt entziehen könnte, sei bei einer Übertragung des Geschäftsanteils an den später mit seinem Geschäftsanteil kaduzierten Mitgesellschafter vor Fälligkeit der fremden Einlageschuld nicht gegeben, weil dann eine Zahlungspflicht noch nicht entstanden sei.
Fortsetzung einer durch Insolvenzeröffnung aufgelösten GmbH nach Schlussverteilung
BGH, Beschluss vom 28. April 2015 – II ZB 13/14
Wird eine GmbH durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen aufgelöst, kann sie nur in den in § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG genannten Fällen fortgesetzt werden. Dies hat der BGH in einem Verfahren entschieden, in dem der Geschäftsführer und alleinige Gesellschafter einer GmbH im Rahmen einer Gesellschafterversammlung die Fortsetzung der Gesellschaft beschlossen hatte. Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der GmbH war zuvor gemäß § 200 InsO nach vollzogener Schlussverteilung aufgehoben worden. Das Handelsregister weigerte sich, die Fortsetzung der Gesellschaft im Handelsregister einzutragen.
Der BGH gab dem Handelsregister Recht. Die Regelung in § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG ordne nicht nur die Auflösung der Gesellschaft im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen an, sondern sehe ausdrücklich die Möglichkeit der Fortsetzung vor, wenn das Verfahren auf Antrag der Gesellschaft gemäß §§ 212, 213 InsO eingestellt oder nach Bestätigung eines Insolvenzplans, welcher den Fortbestand der Gesellschaft vorsieht, aufgehoben wird. Nur in diesen Fällen könne die Gesellschaft durch einen Fortsetzungsbeschluss der Gesellschafter nach allgemeinen Grundsätzen fortgesetzt werden. Der Gesetzgeber habe mit § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG zwei gangbare Wege aufgezeigt, die sowohl den Erhalt der Gesellschaft als auch deren weitere Teilnahme am Marktgeschehen ermöglichen. In den gesetzlich geregelten Fällen, sowohl bei der Fortsetzung der Gesellschaft bei Wegfall der Insolvenzgründe oder der Einstellung des Insolvenzverfahrens mit Zustimmung der Gläubiger nach §§ 212, 213 InsO als auch bei der Beendigung des Insolvenzverfahrens durch einen Insolvenzplan, beseitige das Unternehmen (unter Mitwirkung seiner Gläubiger) die zur Insolvenz führende unternehmerische Krise und bleibe – für die beteiligten Verkehrskreise erkennbar – als wirtschaftliche Einheit aus Sach- und Personalmitteln am Markt erhalten. Bei einer Beendigung des Insolvenzverfahrens nach Schlussverteilung gemäß § 200 InsO bestehe demgegenüber regelmäßig kein fortsetzungsfähiges Unternehmen mehr. Die Auflösungsfolge des § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG diene dem Gläubigerschutz. Es sei im Regelfall nicht zu erwarten, dass die Gesellschaft in den nicht in § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG genannten Fällen nach Abschluss des Insolvenzverfahrens noch über maßgebliches Gesellschaftsvermögen verfüge, welches eine Fortsetzung der Gesellschaft ohne Gefährdung der Gläubiger rechtfertigen könnte.
Eine Erweiterung der von Gesetzes wegen beschränkten Fortsetzungsmöglichkeiten wäre aus Sicht des BGH auch dann nicht geboten, wenn die GmbH im vorliegenden Fall über ein das satzungsgemäße Stammkapital übersteigendes Vermögen verfügt hätte und alle Gläubiger im Insolvenzverfahren befriedigt worden wären. Für eine solche Fortsetzungsmöglichkeit bestehe schon kein Bedürfnis. Ließen die Beteiligten die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit der Fortsetzung ungenutzt, sei kein Grund dafür ersichtlich, eine nicht im Gesetz vorgesehene Möglichkeit zur Fortsetzung der Gesellschaft durch einen schlichten Fortsetzungsbeschluss zu eröffnen. Dagegen spreche vielmehr, dass anders als im Fall des § 212 InsO dann keine gerichtliche Prüfung stattfinden würde, ob die Insolvenzreife überwunden ist.
Forderungsübergang bei Verschmelzung trotz rechtsgeschäftlichem Abtretungsverbot
OLG Düsseldorf, Urteil vom 25. November 2014 – I-21 U 172/12
Das OLG Düsseldorf hatte vorliegend über die in Literatur und Rechtsprechung streitige Frage der Wirksamkeit eines Forderungsübergangs bei einer Verschmelzung nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 UmwG trotz eines zwischen dem übertragenden Rechtsträger als Gläubiger und dem Schuldner vereinbarten Abtretungsverbots zu entscheiden. Der Beklagte hatte die Rechtsvorgängerin der nunmehr insolventen GmbH mit Maurer- und Betonarbeiten beauftragt. Im Bauvertrag war ein Abtretungsverbot mit folgendem Wortlaut vereinbart worden: „Abtretungen werden grundsätzlich gegenseitig für noch nicht erstattete Positionen nicht anerkannt.“. Zwischenzeitlich wurde die ursprüngliche Auftragnehmerin auf die insolvente GmbH verschmolzen. Nachdem Abschlagsrechnungen nicht gezahlt und eine vereinbarte Sicherheitsleistung auch nach Nachfristsetzung nicht erbracht worden war, kündigte die insolvente GmbH den Werkvertrag. Deren Insolvenzverwalter macht nun unter anderem ausstehende Werklohnforderungen geltend.
Das OLG Düsseldorf entschied, dass das rechtsgeschäftlich vereinbarte Abtretungsverbot dem wirksamen Forderungsübergang auf den übernehmenden Rechtsträger im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge anlässlich einer Verschmelzung des Gläubiger auf eine übernehmende Gesellschaft gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 UmwG nicht entgegensteht.
Die Aufrechnungsverbotsklausel habe ihren Hintergrund in dem berechtigten Anliegen des Auftraggebers, den Abrechnungsverkehr klar und übersichtlich zu gestalten und zu verhindern, dass ihm eine Vielzahl von Gläubigern gegenüber steht. Dieses Interesse werde im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Umgruppierungen und Verschmelzungsakte nicht berührt. Dem Rechtsträger, mit dem der Vertragspartner kontrahiert hat, folge ein neuer Rechtsträger in Form der übernehmenden Gesellschaft, in die sämtliche Vermögenswerte, sei es Aktiva wie Passiva, übergegangen seien und zwar in der Größenordnung, wie sie zum Zeitpunkt der Verschmelzung bei der übertragenden Gesellschaft, und damit beim Vertragspartner, bestanden habe.
Darüber hinaus sei es mit Treu und Glauben nicht vereinbar, wenn durch die Gesamtrechtsnachfolge aufgrund der Verschmelzung der Auftraggeber weiterhin einen liquiden Schuldner aus den vertraglichen Regelungen habe, da die Verschmelzung auch zum Übergang der Verbindlichkeiten auf den übernehmenden Rechtsträger führe, während das mit dem übertragenden Rechtsträger geschlossene Abtretungsverbot dazu führen sollte, dass die gegen den Auftraggeber bestehende Forderung nicht auf den übernehmenden Rechtsträger übergehen sollte. Die rechtliche Konsequenz der Anwendbarkeit des Abtretungsverbotes auch auf die Gesamtrechtsnachfolge infolge einer Verschmelzung nach § 20 UmwG bestünde darin, dass der Auftraggeber weiterhin seine vertraglichen Erfüllungs- und Nichterfüllungsansprüche gegenüber dem neuen Rechtsträger, also der übernehmenden Gesellschaft geltend machen könnte, während er letztlich ohne jeglichen Ausgleich von den aus dem Werkvertrag resultierenden Verbindlichkeiten befreit wäre, da sein ursprünglicher Vertragspartner erloschen, also nicht mehr existent wäre (§ 20 Abs. 1 Nr. 2 UmwG). Hierin würde eine nicht gerechtfertigte Besserstellung und Begünstigung des Auftraggebers liegen.
Referenzzeitraum für Ermittlung der Barabfindung bei Squeeze-out
OLG Karlsruhe, Beschluss vom 22. Juni 2015 – 12a W 5/15
Ehemals außenstehende Aktionäre einer börsennotierten AG machen in vorliegendem Spruchverfahren eine angemessene Abfindung nach erfolgtem Squeeze-out geltend. Zwischen der Ankündigung des Squeeze-outs durch den Vorstand der AG im Rahmen der vorangegangenen Hauptversammlung und dem tatsächlichen Hauptversammlungsbeschluss verging ein Zeitraum von 12 Monaten. 10 Monate nach der Ankündigung durch den Vorstand berichtete erstmals die Presse von dem beabsichtigten Ausschluss der Minderheitsaktionäre.
In Anwendung der „Stollwerk“-Rechtsprechung des BGH (Beschluss vom 19. Juli 2010 – II ZB 18/09) stellte das OLG Karlsruhe zunächst fest, dass Stichtag für die Ableitung der angemessenen Barabfindung grundsätzlich der Tag der Bekanntmachung der die Barabfindung auslösenden Strukturmaßnahme ist. Mit der Ankündigung einer Strukturmaßnahme trete die Markterwartung an die Abfindungshöhe an die Stelle der Markterwartung hinsichtlich der Entwicklung des Unternehmenswertes und damit des der Aktie innewohnenden Verkehrswertes. Dies gelte unabhängig davon, ob dieses Wissen durch gezielte Bekanntgabe der beherrschten Gesellschaft oder des Mehrheitsaktionärs oder auf sonstige belastbare Weise in den Markt gelangt sei. Die konkrete Abfindung berechne sich anschließend aus dem nach Umsatz gewichteten Mittel der Börsenkurse der letzten drei Monate vor diesem Stichtag.
In Anwendung dieser Grundsätze legte das OLG Karlsruhe vorliegend den Stichtag nicht erst auf den Tag der Einladung zu der den Squeeze-out beschließenden Hauptversammlung oder auf den Tag der ersten Pressemeldung fest, sondern auf den Tag der erstmaligen Ankündigung des Ausschlusses durch den Vorstand auf der vorausgehenden Hauptversammlung. Dieser Tag sei maßgebend, da diese Ankündigung auf der Hauptversammlung als dem zentralen Willensbildungsorgan der AG geeignet gewesen sei, den Börsenkurs der AG durch Spekulation auf die Höhe der Abfindung zu verzerren. Die Ankündigung sei auch jedenfalls in den maßgeblichen Kreisen interessierter Anleger öffentlich verbreitet worden, wie der Bericht des Börseninformationsdienstes GSC-research über die entsprechende Hauptversammlung belege. Da zwischen dem Stichtag und dem Tag der tatsächlichen Beschlussfassung über den Squeeze-out jedoch im Sinne der „Stollwerk“-Rechtsprechung des BGH ein „längerer Zeitraum“ gelegen habe (hier: 12 Monate), sei vorliegend eine Anpassung des für die Abfindung maßgeblichen Börsenkurses der letzten drei Monate vor dem Stichtag an die allgemeine und branchentypische Kursentwicklung erforderlich.
Ferner bestätigte das OLG Karlsruhe im vorliegenden Beschluss, dass sich handhabbare Kriterien für das Vorliegen einer Marktenge, bei deren Vorliegen der Börsenkurs der Aktie als Bewertungskriterium als untauglich anzusehen gewesen wäre, der Regelung von § 5 Abs. 4 WpÜG-AngebotsVO entnehmen ließen. Demnach sei von einer Marktenge auszugehen, sofern kumulativ während der letzten drei Monate vor dem Stichtag an weniger als einem Drittel der Börsentage Börsenkurse festgestellt wurden und mehrere nacheinander festgestellte Börsenkurse um mehr als fünf Prozent voneinander abgewichen wären. Eine Marktenge lehnte das OLG Karlsruhe jedoch im Ergebnis ab.
Ordnungsgeld-Herabsenkung bei Erfüllung der Publizitätspflichten nach Festsetzung
OLG Köln, Beschluss vom 29. Juni 2015 – 28 Wx 1/15
Eine Gesellschaft war in vorliegendem Verfahren ihren Pflichten zur Offenlegung der Jahresabschlussunterlagen beim Bundesanzeiger erst nach Androhung und Festsetzung eines Ordnungsgeldes nachgekommen. Im folgenden Beschwerdeverfahren setzte das Landgericht Bonn das Ordnungsgeld von EUR 2.500 auf EUR 500 herab. Gegen diese Herabsetzung richtet sich die vorliegende Rechtsbeschwerde.
Das OLG Köln gab der Rechtsbeschwerde statt, da die Herabsetzung des zuvor bereits festgesetzten Ordnungsgeldes nicht habe erfolgen dürfen. Bei einer Erfüllung der Veröffentlichungspflichten erst nach Festsetzung des Ordnungsgeldes komme wegen der eindeutigen Regelung in § 335 Abs. 4 S. 3 HGB eine Herabsenkung des Ordnungsgeldes nach § 335 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 HGB nicht mehr in Betracht und zwar weder durch das Bundesamt für Justiz noch durch das Landgericht im Beschwerdeverfahren.
Eine unmittelbare Anwendung von § 335 Abs. 4 S. 3 HGB scheitere schon am Wortlaut der Vorschrift, wonach bei der Herabsetzung nach § 335 Abs. 4 S. 2 HGB nur Umstände zu berücksichtigen seien, die vor der Entscheidung des Bundesamtes eingetreten sind. Hier wurde aber erst zeitgleich mit der Beschwerde gegen die Festsetzung gehandelt. Für eine entsprechende Anwendung fehle es an einer planwidrigen Regelungslücke, da im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens die Frage einer Herabsetzung des Ordnungsgeldes bei einer verspäteten Nachholung der Offenlegung selbst im Zeitraum nach Festsetzung des Ordnungsgeldes durchaus länger diskutiert worden sei, man sich durch die nun vorliegende Regelung gegen einen solchen Regelungsgehalt entschieden habe.
Gerichtliche Bestimmung eines neuen Hauptversammlungsleiters
OLG Köln, Beschluss vom 16. Juni 2015 – 18 Wx 1/15
Das OLG Köln hatte sich in diesem Verfahren mit dem Prüfungsmaßstab für die gerichtliche Bestellung eines Hauptversammlungsleiters zu befassen. Eine Aktionärsminderheit hatte die Bestimmung eines besonderen Versammlungsleiters gemäß § 122 Abs. 3 S. 2 AktG für die Behandlung derjenigen Tagesordnungspunkte beantragt, die auf ihr Verlangen hin ergänzt wurden.
Das OLG Köln stellte zunächst klar, dass Sinn und Zweck des § 122 Abs. 3 S. 2 AktG es erfordern, auch in den Fällen einen Vorsitzenden der Hauptversammlung gerichtlich zu bestimmen, in denen die Voraussetzungen zur gerichtlichen Bestimmung eines Versammlungsleiters zunächst vorgelegen haben, eine Entscheidung über das Ergänzungsverlangen nach § 122 Abs. 3 S. 1 AktG aber unterbleibt, weil die Gesellschaft unter dem Druck des gerichtlichen Verfahrens dem Verlangen des Minderheitsaktionärs auf Aufnahme bestimmter Gegenstände in die Tagesordnung nachgekommen ist. Maßgeblich dafür, ob das Registergericht von der ihm eingeräumten Befugnis zur Bestimmung eines Versammlungsleiters Gebrauch machen muss, sei dann indes nicht, ob dem Ergänzungsverlangen zu entsprechen gewesen wäre. Vielmehr sei allein entscheidend, ob konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, die darauf schließen ließen, dass eine unparteiische Leitung durch den satzungsmäßig berufenen Versammlungsleiter nicht gewährleistet ist. Nur bei entsprechenden Bedenken, der Versammlungsleiter werde dem Anliegen der Minderheit nicht in gebührender Weise Rechnung tragen, komme eine gerichtliche Bestellung in Betracht.
Diese Bedenken bejahte das OLG Köln im vorliegenden Fall. Ziel der Ergänzung der Tagesordnung sei u.a. die Herbeiführung einer Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gemäß § 147 Abs. 1 S. 2 AktG u.a. gegen frühere und gegenwärtige Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft gewesen. Dabei hätten die Antragsteller den Verdacht von zum Schadenersatz verpflichtenden Verfehlungen auch des derzeitigen Aufsichtsratsvorsitzenden und satzungsmäßig berufenen Versammlungsleiters gehabt. Bereits vor diesem Hintergrund sei zu besorgen, dass dieser dem Anliegen der Minderheit nicht in der gebührenden Weise gerecht werden könne.
Anfechtung eines Entlastungs-Beschlusses in GmbH & Co. KG
OLG München, Urteil vom 22. Juli 2015 – 7 U 2980/12
Die Geschäftsleitung der beklagten GmbH & Co. KG, ein Filmfonds, hatte den Jahresabschluss der Gesellschaft entgegen einer Verpflichtung im Gesellschaftsvertrag sowie entgegen §§ 264 Abs. 1 S. 3, 264a Abs. 1 HGB für mehrere Geschäftsjahre nicht fristgerecht aufgestellt und den Gesellschaftern, unter anderem der Klägerin, vorgelegt. Die Klägerin macht daher die Nichtigkeit der von der Gesellschafterversammlung gefassten Entlastungsbeschlüsse geltend.
Das OLG München gab der Klägerin Recht: Verstoße die Geschäftsleitung in erheblicher Weise sowohl gegen Satzung als auch gegen Gesetz (hier: verspätete Vorlage des Entwurfs des Jahresabschlusses), ohne diesen Verstoß spätestens in der Gesellschafterversammlung zu erklären oder zu rechtfertigen, dürfe ihr Entlastung nicht erteilt werden. Die Geschäftsleitung habe vorliegend sowohl gegen Satzung als auch gegen Gesetz verstoßen, ohne diesen Verstoß spätestens in der Gesellschafterversammlung auch nur ansatzweise zu erklären oder zu rechtfertigen. Es komme hinzu, dass dieses Verhalten gem. §§ 335 Abs. 1 Nr. 1, 335b HGB ordnungsgeldbewehrt sei, so dass auch unter diesem Gesichtspunkt von einem schwerwiegenden Verstoß der Geschäftsleitung – überdies über mehrere Jahre hinweg – auszugehen sei. Gründe dafür, der Geschäftsleitung gleichwohl die Entlastung zu erteilen, seien andererseits nicht ersichtlich und vorgetragen worden.
Anfechtung von Hauptversammlungsbeschlüssen
OLG Stuttgart, Urteil vom 8. Juli 2015 – 20 U 2/14
Das OLG Stuttgart hat eine Klage gegen Beschlüsse der Hauptversammlung der Porsche Automobil Holding SE im Jahr 2013 abgewiesen. Die Klägerin wandte sich gegen Beschlüsse zur Ablehnung des Antrags auf Abwahl des Versammlungsleiters, über die Entlastung des Vorstands und die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 sowie über die Wahl von fünf Aufsichtsratsmitgliedern.
Die Klage gegen die Ablehnung des Antrags auf Abwahl des Versammlungsleiters hielt das OLG Stuttgart mangels Rechtschutzbedürfnisses für eine isolierte Nichtigkeitsfeststellungs- bzw. Anfechtungsklage bereits für unzulässig. Ein Rechtsschutzbedürfnis fehle regelmäßig dann, wenn ein Beschluss angegriffen werde, der einen Antrag ablehnt. In diesem Fall ergebe sich auch bei Erfolg der Klage keine relevante Veränderung der Rechtslage: Der Beschlussantrag bleibe trotz Anfechtung oder Nichtigkeit des ablehnenden Beschlusses erfolglos. Selbst bei Erfolg der Klage hätte dies nur zur Folge, dass der ablehnende Beschluss als nicht gefasst gelten würde. Dies führte aber nicht positiv dazu, dass der Versammlungsleiter als abgewählt gelten würde. Es ändere sich an der Stellung des satzungsmäßig bestimmten Versammlungsleiters nichts. Entgegen der Auffassung der Klägerin wären damit alle folgenden Beschlüsse weiterhin von dem satzungsmäßig bestimmten Versammlungsleiter festgestellt und auch alle sonstigen Handlungen des Versammlungsleiters wirksam. Ein Rechtsschutzinteresse sei allerdings dann regelmäßig zu bejahen, wenn der Kläger seine Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage mit einer positiven Beschlussfeststellungsklage verbindet. Eine positive Beschlussfeststellung gerichtet auf Feststellung der Abwahl des Versammlungsleiters durch die Hauptversammlung wäre in Kombination mit der Anfechtung des ablehnenden Beschlusses statthaft gewesen.
Das OLG Stuttgart stellte zudem klar, dass Vorgänge, die sich nicht auf die Tätigkeit des Versammlungsleiters beziehen, so ein eventuelles Fehlverhalten außerhalb der Hauptversammlung sowie charakterliche Defizite, die sich nicht auf die Hauptversammlungsleitung auswirken, grundsätzlich nicht geeignet seien, einen wichtigen Grund für die Abwahl des Versammlungsleiters darzustellen. Erst recht stelle ein außerhalb der Hauptversammlung liegendes Verhalten regelmäßig keinen Grund dar, der die Treuwidrigkeit der Ablehnung des Abwahlantrags durch die Mehrheit begründen und die Mehrheit der Aktionäre aus Gründen der Treuepflicht gegenüber der Minderheit verpflichten könnte, einem Abwahlantrag zuzustimmen.
Das OLG Stuttgart beschäftigte sich im weiteren Verlauf ausführlich mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen die Anfechtung von Entlastungsbeschlüssen auf Geschehnisse gestützt werden kann, die sich außerhalb des eigentlichen Entlastungszeitraums ereignet haben. Aus Sicht des OLG Stuttgart scheidet eine Anfechtbarkeit aus, wenn die tatsächlichen Umstände, die den Vorwurf einer schwerwiegenden und eindeutigen Pflichtverletzung begründen sollen, aus der Perspektive der Hauptversammlung noch nicht aufgeklärt sind. Eine Anfechtung könne nicht auf Umstände gestützt werden, die erst im Rahmen eines Anfechtungsprozesses aufgeklärt werden sollen. Ferner werde durch die Entlastung nur das Verhalten des zu Entlastenden in dem der Entlastung zugrunde liegenden Zeitraum gebilligt. Auf Handlungen in früheren Zeiträumen könne die Anfechtung des Entlastungsbeschlusses deshalb grundsätzlich nicht gestützt werden.
Das OLG Stuttgart stellte darüber hinaus fest, dass im Hinblick auf zurückliegende in sich abgeschlossene Entscheidungen (hier: Abschluss von Vergütungs- und Abfindungsvereinbarungen) eines möglicherweise anders besetzten Aufsichtsrats der aktuelle Aufsichtsrat grundsätzlich nicht verpflichtet ist, Entscheidungen des Aufsichtsrats der vergangenen Jahre immer wieder daraufhin zu überprüfen, ob diese rechtmäßig waren. Etwas anderes könne allerdings dann gelten, wenn der Aufsichtsrat wisse, dass die abgeschlossenen Verträge unwirksam sind oder er – soweit diese während der eigenen Amtszeit geschlossen wurden – bewusst unwirksame Verträge geschlossen hat oder wenn ihm sich die Unwirksamkeit der Verträge – auch auf Grund neuer Erkenntnisse – aufdrängen musste.
Pressemitteilung des OLG Stuttgart
Kein Wahlrecht ausländischer Arbeitnehmer zum Aufsichtsrat
LG Berlin, Beschluss vom 1. Juni 2015 – 102 O 65/14 AktG
Im Februar diesen Jahres hat das LG Frankfurt (vgl. Noerr Newsletter Ausgabe April 2015) eine viel beachtete Entscheidung getroffen und bei der Berechnung der Schwellenwerte für die Arbeitnehmermitbestimmung im Ausland beschäftigte Arbeitnehmer einbezogen. Das LG Berlin hat dem nun widersprochen und entschieden, dass bei Konzernen mit Sitz der Muttergesellschaft in Deutschland Arbeitnehmern ausländischer Betriebe des Konzerns kein aktives oder passives Wahlrecht bei Aufsichtsratswahlen in Deutschland zusteht.
Diese Sichtweise verstößt nach Ansicht des LG Berlin insbesondere nicht gegen das europäische Diskriminierungsverbot in Artikel 18 AEUV: Der Bereich der unternehmerischen Mitbestimmung gehöre nicht zu den unionsrechtlich harmonisierten Rechtsgebieten. Die Wahlen zum Aufsichtsrat seien ein innerstaatlicher Vorgang, welcher darauf beruhe, dass der deutsche Gesetzgeber es für erforderlich gehalten habe, die Mitbestimmung im Konzern auch auf der obersten Entscheidungsebene anzusiedeln. Der Wahlakt als solcher berühre unmittelbar keine Interessen des europäischen Binnenmarkts. Es sei grundsätzlich hinzunehmen, dass die nationalen Rechte der EU-Staaten ein unterschiedliches Niveau der unternehmerischen Mitbestimmung aufweisen, ohne dass es aus europäischer Sicht einen verbindlichen Mindeststandard geben müsse. Vor diesem Hintergrund zwinge das Diskriminierungsverbot die Mitgliedstaaten nicht, außerhalb ihrer eigenen Regelungskompetenz für eine Gleichbehandlung der Bürger anderer EU-Staaten zu sorgen.
Ferner verstoße die Sichtweise des LG Berlin auch nicht gegen das in Artikel 45 AEUV normierte Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit: Der mit dem Wechsel von einem deutschen Konzernunternehmen zu einer ausländischen Niederlassung verbundene Verlust des Wahlrechts für die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat stelle kein ernsthaftes Hindernis für inländische Arbeitnehmer dar, von ihrem Freizügigkeitsrecht Gebrauch zu machen.
Anfechtbarkeit einer Honorarvereinbarung in der Insolvenz einer AG
LG Frankfurt am Main, Urteil vom 7. Mai 2015 – 2-32 O 102/13
Der Kläger macht als Insolvenzverwalter über das Vermögen einer börsennotierten AG insolvenzanfechtungsrechtliche Rückgewähransprüche und einen Anspruch auf ordnungsgemäße Rechnungslegung für anwaltliche Dienstleistung geltend. Beklagte ist eine Anwaltskanzlei, die die insolvente AG im Zusammenhang mit Sanierungsbemühungen beraten hatte. Für die Sanierungsberatung zahlte die AG an die Beklagte ein Honorar, das der Insolvenzverwalter im Wege der Insolvenzanfechtung zurückverlangt.
Das LG Frankfurt am Main gab dem Insolvenzverwalter Recht und verurteilte die Anwaltskanzlei gemäß §§ 143 Abs. 1 S. 1, 133 Abs. 1 InsO erstinstanzlich zur Rückzahlung der erhaltenen Honorarzahlungen. Honorarzahlungen einer AG an Sanierungsberater seien anfechtbar, wenn sowohl Insolvenzschuldner als auch die Sanierungsberater Kenntnis von der drohenden Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft gehabt hätten und das erarbeitete Sanierungskonzept nicht hinreichend aussichtsreich gewesen sei, so dass es nicht geeignet gewesen ist, die Kenntnis der Beteiligten von der drohenden Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft auszuschließen. Vorliegend sei das Sanierungskonzept u.a. durch zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungskonzepts höchstrichterlich noch nicht geklärte Rechtsfragen nicht nur erkennbar mit Risiken belastet gewesen. Es habe sogar an einer positive Prognose aufgrund konkreter Umstände gefehlt, da die Sanierungsbemühungen über die Entwicklung von Plänen und die Erörterung von Möglichkeiten nicht wesentlich hinausgekommen seien.
Im Hinblick auf die vom Insolvenzverwalter ebenfalls geforderte Auskunftserteilung und Rechnungslegung über die von der beklagten Kanzlei abgerechneten Leistungen in Form einer Angabe der Bearbeitungszeiträume der einzeln zu benennenden Bearbeiter jeweils mit Tätigkeitsbeschreibung lehnte das LG Frankfurt am Main einen entsprechenden Anspruch ab. § 10 RVG, der einen Anspruch auf Aufstellung der Bearbeitungszeiträume jeweils mit Tätigkeitsbeschreibung einräume, sei vorliegend im Rahmen der Vergütungsvereinbarung wirksam ausgeschlossen worden.
Rechtsschutz von Anlegern beim Downgrading einer börsennotierten AG
VG Düsseldorf, Urteil vom 7. August 2015 – 20 L 2589/15
Das VG Düsseldorf hat entschieden, dass Anleger gegen den Widerruf der Zulassung von Wertpapieren zum regulierten Markt einer Börse auf Antrag des Emittenten verwaltungsgerichtlich (hier im Wege eines Antrags auf einstweiligen Rechtsschutz nach § 80a Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 1 Nr. 2 VwGO) vorgehen können. § 39 Abs. 2 S. 2 BörsG vermittele insofern ein subjektiv-öffentliches Recht.
Nach Auffassung des VG Düsseldorf diene § 39 Abs. 2 S. 2 BörsG nicht ausschließlich dem öffentlichen Interesse, sondern zumindest auch dem Interesse Einzelner. Dies folge zunächst aus dem Wortlaut der Norm: Widerrufe die Geschäftsführung einer Börse die Zulassung von Wertpapieren zum Handel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten, dürfe der Widerruf dem „Schutz der Anleger“ nicht widersprechen (§ 39 Abs. 2 Sätze 1 und 2 BörsG). Im Mittelpunkt des § 39 Abs. 2 S. 2 BörsG stünden also die Inhaber der Unternehmensaktien. Deren Schutz sei bei der Ermessensentscheidung der Geschäftsführung über den Widerruf zu berücksichtigen. Der Wortlaut des Gesetzes spreche dafür, dass (einzelne) Anleger sich auch auf die Nichtberücksichtigung ihres Schutzes und damit die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorgaben berufen können.
Dass § 39 Abs. 2 S. 2 BörsG – wie andere börsenrechtliche Vorschriften – ausschließlich öffentlichen Interessen dienen soll, ließe sich schon deswegen schwerlich annehmen, weil die Norm im Unterschied zu anderen Bestimmungen des Börsengesetzes ausdrücklich den Schutz von Anlegern im Sinne von Wertpapierinhabern in den Blick nehme. Ungeachtet dessen, ob sich Anleger beim Widerruf der Zulassung auf Antrag des Emittenten auf die Verletzung von Grundrechten berufen können, folge das subjektiv-öffentliche Recht zumindest aus der Vorschrift selbst und den nach Maßgabe des Satzes 5 erlassenen näheren Bestimmungen der Börsenordnung. Art. 19 Abs. 4 GG gebiete, den Rechtsweg jedenfalls zur Überprüfung dieser Vorgaben zu eröffnen. Denn die Börse erlasse mit dem Widerruf der Zulassung als teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts (§ 2 Abs. 1 BörsG) einen Verwaltungsakt als actus contrarius zur ursprünglichen Zulassung. Da sie als Trägerin öffentlicher Gewalt im Sinne von Art. 19 Abs. 4 GG handele, sei der Rechtsweg für diejenigen, die in der Norm als Inhaber subjektiver Rechte benannt sind, eröffnet. Namentlich in der Folge der „Frosta“-Entscheidung des BGH (Beschluss vom 8. Oktober 2013 – II ZB 26/12) wären die Anleger sonst rechtsschutzlos gestellt. In bezeichnetem Beschluss hatte der BGH bei einem Widerruf der Börsenzulassung für den regulierten Markt einen Anspruch der Aktionäre auf Barabfindung und auf einen Hauptversammlungsbeschluss abgelehnt und auf den öffentlich-rechtlich ausgestalteten Anlegerschutz gemäß § 39 Abs. 2 S. 2 BörsG und die Möglichkeit verwaltungsgerichtlichen Schutzes verwiesen.
Auch stehe § 15 Abs. 6 BörsG der Annahme eines subjektiv-öffentlichen Rechts der Aktieninhaber nicht entgegen. Zwar sehe § 15 Abs. 6 BörsG vor, dass die Geschäftsführung die ihr nach dem Börsengesetz zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse nur im öffentlichen Interesse wahrnimmt. Zu den Aufgaben und Befugnissen im Sinne von § 15 Abs. 6 BörsG gehöre zwar auch die Zulassung von Wertpapieren und deren Widerruf gemäß § 32 ff. BörsG. Dies schließe aber nicht aus, dass jedenfalls § 39 Abs. 2 S. 2 BörsG – zumindest auch – den Schutz Einzelner im Blick hat. Die Geschäftsführung habe bei der Widerrufsentscheidung das öffentliche Interesse am ordnungsgemäßen Börsenhandel zu berücksichtigen. Sie habe überdies den Anlegerschutz insbesondere nach Maßgabe der Börsenordnung in ihre Entscheidung einzubeziehen.
Gesetzgebung
Frauenquote – Festlegung von Zielgrößen bis 30. September 2015/Praxisleitfaden
Am 1. Mai 2015 ist das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst in Kraft getreten (vgl. Noerr Newsletter Ausgabe Mai 2015). Das Gesetz hat neben einer gesetzlichen Quote in Höhe von 30 Prozent für den Aufsichtsrat von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen auch die Verpflichtung für bestimmte Unternehmen eingeführt, sich selbst Zielgrößen zum Frauenanteil und Fristen zu deren Erreichung zu setzen. Danach müssen Unternehmen, die entweder börsennotiert oder mitbestimmt sind, erstmals zum 30. September 2015 Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und im Vorstand (§ 111 Abs. 5 AktG, § 52 Abs. 2 GmbHG) bzw. in der Geschäftsführung (§ 52 Abs. 2 GmbHG) sowie für die zwei Führungsebenen unterhalb des Vorstands/der Geschäftsführung (§ 76 Abs. 4 AktG, § 36 GmbHG) festlegen.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat kürzlich auf ihrer Internetseite einen Praxisleitfaden zum Gesetz veröffentlicht, der unter anderem über die gesetzlichen Anforderungen informiert sowie Ansätze und Instrumente vorstellt, wie die Unternehmen ihre Führungsetagen mit mehr Frauen besetzen können.
Pressemitteilung des BMJV
Überarbeitung der Aktionärsrechterichtlinie
Das EU-Parlament hat am 8. Juli 2015 Änderungen des Entwurfs der EU-Kommission zur Änderung der Richtlinie 2007/36/EG im Hinblick auf die Förderung der langfristigen Einbeziehung der Aktionäre sowie der Richtlinie 2013/34/EU in Bezug auf bestimmte Elemente der Erklärung zur Unternehmensführung (vgl. Noerr Newsletter Ausgabe April 2014) beschlossen. Auf Basis dieses Vorschlages des EU-Parlaments werden nun die Trilogverhandlungen mit Rat und Kommission aufgenommen.
Der vom Parlament geänderte Entwurf regelt nach wie vor, dass Aktionäre mindestens alle 3 Jahre über die Vergütungspolitik für die Mitglieder der Unternehmensleitung einer börsennotierten Gesellschaft und einen entsprechenden Vergütungsbericht abstimmen müssen. Die Mitgliedstaaten können nun aber entscheiden, ob das Ergebnis einer solchen Abstimmung durch die Aktionärsversammlung verbindlichen oder lediglich beratenden Charakter haben soll. Die im Kommissionsentwurf vorgesehenen umfangreichen Kriterien zur Festlegung der Vergütungspolitik, die nach Genehmigung durch die Aktionäre zu veröffentlichen ist, wurden gekürzt. So wurde die Offenlegung und Begründung des Verhältnisses der Vergütung der Mitglieder der Unternehmensleitung zur durchschnittlichen Vergütung eines Vollzeitbeschäftigten sowie die Angabe der Höchstbeträge der Gesamtvergütung gestrichen. Neu hinzugekommen sind die Leitlinien, dass der Aktienwert bei den finanziellen Leistungskriterien keine vorrangige Rolle spielen soll und die aktienbezogene Vergütung bei Mitgliedern der Unternehmensleitung nicht der wichtigste Bestandteil ihrer Vergütung sein sollte.
Auch die von der Kommission ursprünglich vorgeschlagene und im Nachgang teils recht kontrovers diskutierte Regelung über ein Recht der Aktionäre auf Abstimmung über Transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen wurden vom EU-Parlament umfangreich geändert und zugunsten der Mitgliedstaaten gelockert. Danach müssen lediglich noch „wesentliche“ Transaktionen mit nahe stehenden Unternehmen und Personen spätestens zum Zeitpunkt ihres Abschlusses öffentlich bekannt gemacht und der Bekanntmachung ein Bericht (nicht mehr zwingend eines unabhängigen Dritte) beigefügt werden. Eine Genehmigung solcher Transaktionen soll nicht mehr zwingend seitens der Aktionäre erfolgen, sondern kann auch durch das Aufsichtsorgan des Unternehmens möglich sein. Ferner räumt der Regelungsvorschlag den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, bestimmte Transaktionen von dem Genehmigungserfordernis auszunehmen und selbst festzulegen, welche Transaktionen als „wesentlich“ im Sinne der Vorschrift anzusehen sind.
Das EU-Parlament beabsichtigt zudem, für bestimmte große Unternehmen zusätzliche Offenlegungspflichten im Rahmen des Anhangs zum Jahresabschluss einzuführen. Die Informationen sollen aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten und Drittländern, in denen sie über ein Tochterunternehmen verfügen („Country-by-Country Reporting“), zur Verfügung gestellt werden und u.a. Angaben zu Umsatz, Gewinn/Verlust vor Steuern, Steuern auf Gewinn/Verlust, erhaltene staatliche Beihilfen erfassen.
Angenommener Text und Pressemitteilung des EU-Parlaments; Zusammenfassung (englisch) des EU-Parlaments
Datenschutz beim Unternehmenskauf
Anlässlich der Verhängung von Bußgeldern an die Parteien eines Unternehmenskaufvertrages hat des Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht eine Stellungnahme zu der Frage der Zulässigkeit des Verkaufs und der Übermittlung von personenbezogenen Kundendaten im Rahmen von Asset-Deals veröffentlicht.
Das Bayerische Landesamt stellt hierin klar, dass die Übermittlung von Namen und Postanschriften von Kunden grundsätzlich auch ohne vorherige Einwilligung des Betroffenen für werbliche Zwecke übermittelt werden dürfen: Voraussetzung sei jedoch, dass das veräußernde Unternehmen die Übermittlung dokumentiert. Die Übermittlung darüber hinausgehender Kundendaten wie Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Konto- und/oder Kreditkartendaten sowie Informationen über die von Kunden getätigte Käufe sei jedoch nur zulässig, wenn die betreffenden Kunden in die Übermittlung solcher Daten eingewilligt haben oder zumindest – bereits im Vorfeld – auf die geplante Übermittlung hingewiesen, ihnen ein Widerspruchsrecht eingeräumt wurde und sie nicht widersprochen haben.
Pressemitteilung des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht
Notarielle Beurkundungen in fremder Sprache
Mit Inkrafttreten des Gesetzes über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare (GNotKG) am 1. August 2013 war in Nr. 26001 des Kostenverzeichnisses zum GNotKG festgelegt worden, dass der Notar eine zusätzliche Fremdsprachengebühr von 30 Prozent für das Beurkundungsverfahren erheben kann, wenn (i) ein Beteiligter Erklärungen in einer fremden Sprache abgibt, ohne dass ein Dolmetscher hinzugezogen wird; (ii) eine Beurkundung, Beglaubigung oder Bescheinigung in einer fremden Sprache erfolgt; oder (iii) eine Erklärung in eine andere Sprache übersetzt wird.
Durch Artikel 13 Nr. 10 lit. v) des Gesetzes zum Internationalen Erbrecht und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften vom 29. Juni 2015 (BGBl I, 2015, S. 1042-1060) ist diese Gebühr nun auf höchstens EUR 5.000 gedeckelt worden. Der Gesetzgeber gelangte nach Einführung dieses Kostentatbestands zu der Erkenntnis, dass bei sehr hohen Geschäftswerten die nicht zusätzlich gedeckelte Gebührenhöhe auch im Hinblick auf den Zeitaufwand und das Haftungsrisiko für den Notar nicht mehr angemessen sei.
Möchten Sie diesen Noerr-Newsletter künftig per E-Mail beziehen? Klicken Sie auf der rechten Seite auf 'jetzt anmelden'.
Archiv: