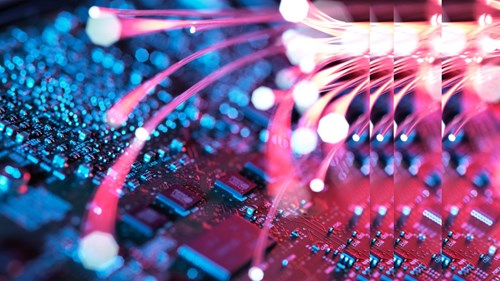Überblick Rechtsprechung im Gesellschaftsrecht 04/2017
Kein Recht auf Löschung von personenbezogenen Daten im Gesellschaftsregister
EuGH, Urteil vom 9. März 2017 – C-398/15
Der Geschäftsführer einer Gesellschaft klagte gegen die italienische Handelskammer Lecce auf Löschung seiner Eintragung als Geschäftsführer einer 1992 insolvent gewordenen und 2005 liquidierten Gesellschaft. Er trug vor, dass die Verbindung seiner Person mit der Insolvenz dieser Gesellschaft nachteiligen Einfluss auf seine heutige Geschäftstätigkeit habe. Der von der Handelskammer Lecce angerufene Kassationsgerichtshof hatte dem EuGH nach erstinstanzlicher Verurteilung der Handelskammer zur Löschung der personenbezogenen Daten die Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob es die Richtlinie zum Schutz der Daten natürlicher Personen und die Richtlinie über die Offenlegung von Gesellschaftsurkunden verbieten, dass jede Person ohne zeitliche Beschränkung Zugang zu natürliche Personen betreffende Daten im Gesellschaftsregister haben kann.
Die Fragen verneinte der EuGH in vorliegendem Urteil: Es ist mit europäischem Recht vereinbar, dass jede Person ohne zeitliche Beschränkung Zugang zu natürliche Personen betreffenden Daten im Gesellschaftsregister haben kann. Die Offenlegung der personenbezogenen Daten diene dazu, die Interessen Dritter gegenüber Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung zu schützen, da diese zum Schutz Dritter lediglich ihr Gesellschaftsvermögen zur Verfügung stellen. Die Offenlegung solle es Dritten daher erlauben, sich über die wesentlichen Urkunden der Gesellschaft sowie einige sie betreffende Angaben, insbesondere die Personalien derjenigen, die die Gesellschaft verpflichten können, zu unterrichten. Auch nach der Auflösung einer Gesellschaft könnten Rechte und Rechtsbeziehungen fortbestehen, die sich auf dieses Unternehmen beziehen. So können sich die Daten zum Beispiel im Streitfall als relevant erweisen für die Prüfung, ob eine im Namen der Gesellschaft während ihrer Tätigkeit vorgenommene Handlung rechtmäßig war, oder damit Dritte gegen Mitglieder von Organen oder gegen Liquidatoren einer Gesellschaft eine Klage anstrengen können. In Anbetracht der Vielzahl der möglichen Szenarien, in denen Akteure in mehreren Mitgliedstaaten beteiligt sein können, sowie der erheblichen Unterschiede in den Verjährungsfristen der nationalen Rechtsordnungen für die verschiedenen Rechtsgebiete, erscheint es dem EuGH derzeit nicht möglich, eine einheitliche Frist festzulegen, die mit der Auflösung einer Gesellschaft zu laufen beginnt und nach deren Ablauf die Eintragung der Daten im Register und ihre Offenlegung nicht mehr notwendig wären. Demzufolge könnten die Mitgliedstaaten den in den Registern genannten Personen nicht das Recht garantieren, grundsätzlich nach einer bestimmten Frist nach Auflösung der betreffenden Gesellschaft die Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder ihre Sperrung für die Öffentlichkeit zu erhalten.
Der EuGH schließt jedoch nicht aus, dass es besondere Situationen gibt, in denen es aus überwiegenden, schutzwürdigen, sich aus dem konkreten Fall der betroffenen Person ergebenden Gründen ausnahmsweise gerechtfertigt ist, den Zugang zu den im Register eingetragenen personenbezogenen Daten nach Ablauf einer hinreichend langen Frist nach der Auflösung der fraglichen Gesellschaft auf Dritte zu beschränken, die ein besonderes Interesse an der Einsichtnahme in diese Daten nachweisen. Ob eine betroffene Person die mit der Führung des Registers betraute Stelle um eine solche Zugangsbeschränkung zu den sie betreffenden personenbezogenen Daten auf der Grundlage einer Einzelfallbeurteilung ersuchen kann, sei jedoch Sache der nationalen Gesetzgeber. Es sei Sache des vorlegenden Gerichts, den Stand seines nationalen Rechts in dieser Hinsicht zu überprüfen.
Pressemitteilung des EuGH
Rückkehr zum satzungsmäßigen Geschäftsjahr durch Insolvenzverwalter
BGH, Beschluss vom 21. Februar 2017 – II ZB 16/15
Der Antragsteller ist Insolvenzverwalter in dem am 3. Dezember 2013 eröffneten Insolvenzverfahren über das Vermögen einer GmbH. Satzungsgemäßes Geschäftsjahr der GmbH ist das Kalenderjahr. Unmittelbar nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens hatte der Antragsteller eine Steuerberatungsgesellschaft mit der Erstellung der Jahresabschlüsse zu den satzungsmäßigen Geschäftsjahren beauftragt und dies dem Finanzamt sowie dem Sicherheitentreuhänder als größtem Gläubiger mitgeteilt. Mit Schreiben vom 27. Januar 2015 erklärte der Antragsteller, dass für die Zeit vom 3. Dezember 2013 bis 31. Dezember 2013 ein Rumpfgeschäftsjahr festgesetzt werde. Für die nachfolgenden Geschäftsjahre werde wieder das Kalenderjahr als Geschäftsjahr festgesetzt. Das Registergericht hatte die Eintragung der Änderung des Geschäftsjahres nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens zurückgewiesen. Die Beschwerde dagegen blieb ebenfalls erfolglos. Diese Entscheidungen bestätigte nun der BGH.
Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens beginnt gemäß § 155 Abs. 2 S. 1 InsO ein neues Geschäftsjahr. Das bisher laufende Geschäftsjahr wird dadurch zu einem Rumpfgeschäftsjahr. Der Insolvenzverwalter ist aber befugt, das Geschäftsjahr wieder so festzulegen, wie es in der Satzung vereinbart ist. Die dahingehende Entscheidung des Insolvenzverwalters muss nach außen erkennbar werden, und zwar jedenfalls noch während des ersten laufenden Geschäftsjahrs nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Das kann durch eine Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister geschehen, aber auch durch eine sonstige Mitteilung an das Registergericht.
Das Beschwerdegericht hat vorliegend aus Sicht des BGH mit Recht angenommen, dass die Verlautbarung des Insolvenzverwalters gegenüber der Steuerberatungsgesellschaft, dem Finanzamt und dem Sicherheitentreuhänder unmittelbar nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens keine ausreichende Mitteilung zur Rückkehr zum satzungsmäßigen Geschäftsjahr darstellt. Wenn im Handelsregister nur der Insolvenzvermerk verlautbart ist, sei davon auszugehen, dass das mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 155 Abs. 2 S. 1 InsO begonnene neue Geschäftsjahr weiterläuft und sich dieser Geschäftsjahresrhythmus fortsetzt. Die Rückkehr zum vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens geltenden Geschäftsjahresrhythmus müsse der Insolvenzverwalter daher gegenüber dem Registergericht erkennbar machen. Zwar sei die Handelsregistereintragung nicht konstitutiv für die Umstellung des Geschäftsjahrs, die Kundgabe des Willens zur Rückkehr zum satzungsmäßigen Kalenderjahr nur gegenüber dem Steuerberater, dem Wirtschaftsprüfer, dem Finanzamt, einem Gläubiger oder anderen Personen, genüge diesen Anforderungen jedoch nicht.
Die Mitteilung des Antragstellers zur Rückkehr zum satzungsmäßigen Geschäftsjahr der Gesellschaft gegenüber dem Registergericht vom 27. Januar 2015 war aus Sicht des BGH hingegen verspätet, da die Entscheidung des Insolvenzverwalters, das mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 155 Abs. 2 S. 1 InsO begonnene neue Geschäftsjahr zu ändern, noch während des ersten laufenden Geschäftsjahrs nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens getroffen und nach außen erkennbar werden muss.
Grundbuchfähigkeit einer ausländischen (hier: italienischen) Gesellschaft
BGH, Beschluss vom 9. Februar 2017 – V ZB 166/15
Die Beteiligte 2 in vorliegendem Grundbuchbeschwerdeverfahren beantragte die Eintragung einer Auflassungsvormerkung zu ihren Gunsten, nachdem sie von der Beteiligten 1 Wohnungseigentum erworben hatte. Die Beteiligte 2 ist eine società semplice („einfache Gesellschaft“) italienischen Rechts. Das Grundbuchamt wies den Antrag auf Eintragung der Auflassungsvormerkung ab, das KG Berlin die dagegen erhobene Beschwerde zurück. Nach seiner Auffassung setze die Eintragung einer ausländischen Gesellschaft in das Grundbuch deren Rechtsfähigkeit voraus. Hieran fehle es nach dem insoweit maßgeblichen italienischen Recht.
Der BGH folgte dieser Ansicht nicht, gab der Rechtsbeschwerde statt und verwies das Verfahren zur erneuten Entscheidung zurück an das KG Berlin. Zwar könne eine ausländische Gesellschaft nur dann unter ihrem Namen als Vormerkungsberechtigte in das Grundbuch eingetragen werden, wenn sie nach ihrem Personalstatut (hier das italienische Recht) selbst Eigentum an Grundstücken erwerben könne und ihr damit nach dem deutschen Grundbuchverfahrensrecht die materielle Grundbuchfähigkeit zukomme. Das Beschwerdegericht habe vorliegend aber das italienische Recht nur unzureichend ermittelt. Für die Grundbuchfähigkeit der Beteiligten 2 sei nicht entscheidend, ob nach italienischem Recht eine umfassende Rechtsfähigkeit der società semplice besteht. Da das Gesetz auch eine auf bestimmte Bereiche (wie etwa den Erwerb von Grundstücken) beschränkte Teilrechtsfähigkeit vorsehen könne, komme es vielmehr darauf an, ob die ausländische Gesellschaft selbst Trägerin von Rechten an Grundstücken sein könne. Die zur Klärung dieser Frage vom KG Berlin herangezogene (deutsche) Literatur sei insofern nicht eindeutig und die maßgeblichen Normen des italienischen Codice Civile seien lediglich mit einem aus dem bloßen Wortlaut abgeleiteten Verständnis angewandt worden. Es sei versäumt worden, das italienische Recht als Ganzes und die hierauf bezogene italienische Rechtspraxis ausreichend zu ermitteln. Der BGH hält für die erneute Entscheidung die Einholung eines Rechtsgutachtens bzw. ein Auskunftsersuchen für geboten, um zu klären, ob die Beteiligte 2 nach italienischem Recht in eigener Rechtsträgerschaft Wohnungseigentum erwerben kann.
Nichtigkeit eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots
BAG, Urteil vom 22. März 2017 – 10 AZR 448/15
Die Klägerin im vorliegenden arbeitsgerichtlichen Verfahren war bis zu ihrer ordentlichen Kündigung bei der Beklagten beschäftigt. Im Arbeitsvertrag war ein Wettbewerbsverbot vereinbart. Danach durfte die Klägerin für die Dauer von zwei Jahren nach Beendigung des Vertrags nicht in selbständiger, unselbständiger oder sonstiger Weise für ein mit der Beklagten konkurrierendes Unternehmen tätig sein. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung war eine Vertragsstrafe vorgesehen. Eine Karenzentschädigung sah der Arbeitsvertrag nicht vor. Der Arbeitsvertrag enthielt darüber hinaus eine sogenannte salvatorische Klausel. Nach dieser sollte an Stelle einer etwaig nichtigen oder unwirksamen Bestimmung eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben bzw. gewollt hätten, sofern sie bei Abschluss des Vertrags die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit bedacht hätten. Mit der vorliegenden Klage verlangt die Klägerin Zahlung einer Karenzentschädigung. Die Vorinstanzen hatten der Klägerin eine Karenzentschädigung zugesprochen. Dem widersprach nun das BAG in vorliegendem Urteil.
Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot sei nichtig, wenn die Vereinbarung entgegen § 110 GewO in Verbindung mit § 74 Abs. 2 HGB keinen Anspruch des Arbeitnehmers auf eine Karenzentschädigung beinhaltet. Die Nichtigkeit habe zur Folge, dass der Arbeitgeber aufgrund einer solchen Vereinbarung nicht verlangen könne, dass der Angestellte das Wettbewerbsverbot einhalte. Die ehemalige Arbeitnehmerin könne aber trotz Einhaltung des nichtigen Wettbewerbsverbots keine Karenzentschädigung verlangen.
Eine im als Allgemeine Geschäftsbedingungen zu qualifizierenden Arbeitsvertrag enthaltene salvatorische Klausel könne einen Verstoß gegen § 74 Abs. 2 HGB nicht ̶ auch nicht einseitig zu Gunsten des ehemaligen Arbeitnehmers ̶ heilen. Wegen der Notwendigkeit, spätestens unmittelbar nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Entscheidung über die Einhaltung des Wettbewerbsverbots zu treffen, müsse sich die (Un-)Wirksamkeit aus der Vereinbarung ergeben. Daran fehle es bei einer salvatorischen Klausel, nach der wertend zu entscheiden sei, ob die Vertragsparteien in Kenntnis der Nichtigkeit der Vereinbarung eine wirksame Vereinbarung abgeschlossen hätten und welchen Inhalt die Entschädigungszusage gehabt hätte.
Pressemitteilung des BAG
Firmierung einer inländischen Zweigniederlassung
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 22. Februar 2017 – I-3 Wx 145/16
Eine niederländische B.V. unterhielt bereits seit Jahren in Deutschland eine Zweigniederlassung unter derselben Firma wie die niederländische Hauptniederlassung. Diese war zunächst in das Handelsregister des AG Hamburg, sodann (seit 2015) in dasjenige des AG Frankfurt am Main eingetragen. Mit notariell beglaubigter Erklärung meldete ein Geschäftsführer der B.V. die Verlegung der Zweigniederlassung von Frankfurt am Main nach Düsseldorf beim Handelsregister an. Das Registergericht Düsseldorf verweigerte die Eintragung, weil die bestehende Firmierung der Zweigniederlassung den Eindruck erwecke, im deutschen Handelsregister sei eine „B.V.“ eingetragen, was nicht zutreffe; diese sei vielmehr in den Niederlanden eingetragen. Aus der einzutragenden Firmierung müsse sich zweifelsfrei ergeben, dass nur eine Zweigniederlassung eingetragen sei.
Dieser Ansicht widersprach das OLG Düsseldorf in der vorliegenden Beschwerdeentscheidung. Aus Sicht des OLG Düsseldorf besteht die vom Registergericht geltend gemachte Irreführungsgefahr nach § 18 Abs. 2 HGB nicht, wenn im vorliegenden Fall die Zweigniederlassung der Gesellschaft mit Sitz und Hauptniederlassung in den Niederlanden sowie einer Firma nach niederländischem Recht hier ohne einen auf die Eigenschaft als Zweigniederlassung hinweisenden Zusatz eingetragen wird. § 13d HGB, der die eine inländische Zweigniederlassung einer ausländischen Gesellschaft betreffenden Eintragungen im Handelsregister regele, bestimme in Abs. 2, 2. Halbsatz, dass, falls der Firma der Zweigniederlassung ein Zusatz beigefügt sei, auch dieser einzutragen sei. Es erscheine aber kein Fall denkbar, in dem die Übernahme der Firma der ausländischen Gesellschaft in die Handelsregistereintragung der inländischen Zweigniederlassung nicht den Eindruck hervorrufen könnte, eingetragen sei hier die ausländische Gesellschaft als solche (und nicht lediglich deren Zweigniederlassung), demzufolge ein Zusatz unterbleiben könne. Daher sei die vom Registergericht vertretene Ansicht, nach der immer ein die Zweigniederlassung ausweisender Zusatz erforderlich wäre, mit dem konditionalen Wortlaut der Regelung („ist…beigefügt, so…“) nur schwer vereinbar.
Für inländische Gesellschaften werde ein eine Zweigniederlassung ausweisender Zusatz im Grundsatz nicht gefordert. Nur falls für die Zweigniederlassung eine andere Firma als für die Hauptniederlassung gewählt wurde, müsse über einen solchen Zusatz die Zugehörigkeit der Zweigniederlassung zu jener Gesellschaft zum Ausdruck gebracht werden. Wieso für ausländische Unternehmen strengere Anforderungen gelten sollten, erschließt sich aus Sicht des OLG Düsseldorf nicht. Insbesondere werde aus Rechtsgeschäften ohnehin nicht die rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, sondern die ausländische Gesellschaft verpflichtet und aus den weiteren Eintragungen im Handelsregister gehe durchaus die Eigenschaft als Zweigniederlassung hervor. Zudem werde die europarechtlich vorgegebene Niederlassungsfreiheit maßgeblich auch dadurch verwirklicht, unter derselben Firma im gesamten europäischen Raum tätig zu sein, mithin dadurch, dass ein ausländischer Rechtsträger seine Firma grundsätzlich unverändert und ohne Zusätze auch für im Inland eingerichtete Zweigniederlassungen verwenden darf.
Squeeze-out-Abfindung bei Bestehen eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15. November 2016 – I-26 W 2/16
Nach § 327b Abs. 1 S. 1 AktG muss der Hauptaktionär den Minderheitsaktionären beim Squeeze-out eine Barabfindung anbieten, die in ihrer Höhe eine volle wirtschaftliche Kompensation des Anteilseigentums der Minderheitsaktionäre darstellen muss. Nach der Rechtsprechung des BGH wird die Höhe der Barabfindung nach dem Ertragswertverfahren ermittelt; der durchschnittliche Börsenkurs der letzten drei Monate vor Bekanntgabe des beabsichtigten Squeeze-outs stellt dabei die Untergrenze der angemessenen Abfindung dar. Auch bei Bestehen eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags ist nach Ansicht des BGH trotz der finanziellen und operativen Integration des vom Squeeze-out betroffenen Unternehmens in das herrschende Unternehmen der Ertragswert der beherrschten Gesellschaft als Grundlage für die Barabfindungsbemessung und nicht der Barwert der aufgrund des Unternehmensvertrags dem Minderheitsaktionär zustehenden Ausgleichszahlung maßgeblich. Der BGH hat allerdings bislang ausdrücklich die Frage offengelassen, ob der Barwert der Ausgleichszahlungen ähnlich dem Börsenwert als Mindestwert der angemessenen Abfindung zugrunde zu legen ist, wenn dieser den anteiligen Unternehmenswert zum Zeitpunkt des Ausschlusses der Minderheitsaktionäre übersteigt.
Vorliegend hatte der Mehrheitsaktionär dem Minderheitsaktionär im Rahmen des Squeeze-outs eine Barabfindung angeboten, die der Höhe der seinerzeit bei Abschluss des Unternehmensvertrags angebotenen Abfindung entsprach und den ermittelten Ertragswert der Aktien überstieg. Das LG Köln hatte in erster Instanz die Barabfindung auf Grundlage eines Sachverständigengutachtens erhöht. Die klagenden Minderheitsaktionäre halten den erstinstanzlich festgestellten erhöhten Wert immer noch für zu gering. Es sei insbesondere zu klären, ob der Barwert der Ausgleichszahlungen „ähnlich dem Börsenwert“ als Mindestwert zugrunde zu legen sei, wenn er den anteiligen Unternehmenswert zum Zeitpunkt des Ausschlusses der Minderheitsaktionäre übersteigt. Dies sei vorliegend entscheidungserheblich, weil verschiedene Antragsteller Barwerte errechnet hätten, die über der festgesetzten Abfindung lägen.
Das OLG Düsseldorf bestätigte die vom LG Köln festgelegte Abfindungshöhe. Es stellte fest, dass sich die Höhe der angemessenen Barabfindung ̶ auch in den Fällen, in denen ein Squeeze-out einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag nachfolgt ̶ regelmäßig nicht auf der Basis des Barwerts des Ausgleichs aus dem früheren Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag berechnet. Vielmehr bilde auch in diesem Fall der Unternehmenswert zum Zeitpunkt des Squeeze-out-Beschlusses die Grundlage der Barabfindung. Der Barwert der Ausgleichszahlungen sei schon im Ansatz ungeeignet, den stichtagsbezogenen „wirklichen“ oder „wahren“ Wert des Anteilseigentums – auch als Mindestwert – widerzuspiegeln. Die Berechnung des Barwerts der Ausgleichszahlungen könne als Schätzgrundlage oder Mindestwert die verfassungsrechtlich gebotene volle Entschädigung des Aktionärs nicht gewährleisten, weil sie als „Methode“ auf Annahmen zum Fortbestand des Unternehmensvertrags fuße, die regelmäßig nicht belastbar seien. Bei dem Barwert einer wiederkehrenden Zahlung handele es sich um den Rechenwert, den eine zukünftig anfallende Zahlungsreihe an einem bestimmten Tag besitzt; zur Berechnung würden zukünftige Zahlungen abgezinst und anschließend summiert. Um den Barwert der Ausgleichszahlungen aus dem Unternehmensvertrag zum Zeitpunkt des Squeeze-out-Beschlusses zu berechnen, seien deshalb Annahmen zu treffen, welche künftigen Zahlungen dem Aktionär voraussichtlich zugeflossen wären. Es bedürfe dazu einer hinreichend gesicherten Prognose, welcher Zeitraum für das Bestehen eines Unternehmensvertrags zugrunde gelegt werden solle. Dabei ohne Rücksicht auf die konkreten Verhältnisse fiktiv davon auszugehen, der Unternehmensvertrag werde zur nächsten Kündigungsmöglichkeit beendet, erscheint aus Sicht des OLG Düsseldorf in diesem Zusammenhang ebenso bedenklich, wie ohne weiteres mangels jedweder Anhaltspunkte von einer ewigen Vertragslaufzeit auszugehen. Dies gelte umso mehr, als die möglichen Gründe für die Beendigung von ̶ regelmäßig für die Dauer von fünf Jahren mit anschließender jährlicher Kündigungsmöglichkeit abgeschlossenen ̶ Unternehmensverträgen vielfältig seien.
Angesichts dessen habe das LG Köln zu Recht darauf hingewiesen, dass sich Ausgleich und Abfindung wesentlich unterscheiden. Die Ausgleichszahlung stelle wirtschaftlich einen pauschalierten Ausgleich für die Dividende dar, während die Barabfindung den Anteil des Aktionärs an der Vermögenssubstanz repräsentiere. Die Ausgleichszahlung entschädige den Aktionär nicht für sein Ausscheiden aus dem Unternehmen und den Verlust der ihm durch die Aktie vermittelten mitgliedschaftlichen Herrschaftsrechte, deren Verlust bei der Bestimmung des „wahren“ Werts der Beteiligung ebenfalls zu berücksichtigen sei. Maßgeblich für die Bewertung sei damit gerade nicht eine allein ökonomische Betrachtung, welche Zahlungsströme der Aktionär (möglicherweise) zu erwarten habe.
Das OLG Düsseldorf hielt es in seiner Entscheidung auch für nicht geboten, den Barwert der Ausgleichszahlungen aufgrund des Unternehmensvertrags ähnlich dem Börsenwert als Mindestwert für eine etwaige Squeeze-out Barabfindung anzusetzen. Eine Vergleichbarkeit von Börsenwert und Ausgleichszahlung liege nicht vor. Die Aktie sei aus der Sicht des Kleinaktionärs gerade deshalb so attraktiv, weil er sein Kapital nicht auf längere Sicht binde, sondern sie fast ständig wieder veräußern könne. Daher dürfe die Verkehrsfähigkeit als Eigenschaft des Aktieneigentums bei der Wertbestimmung des Eigentumsobjekts in Form eines existierenden Börsenkurses der beherrschten Gesellschaft bei der Bemessung der Barabfindung nicht außer Betracht bleiben. Die Ausgleichszahlung hingegen vermittele keine damit vergleichbare grundrechtlich relevante Rechtsposition. Der Anspruch auf Ausgleichszahlung sei kein mitgliedschaftliches Recht. Er beinhalte lediglich ein ̶ vorübergehendes ̶ schuldrechtliches Forderungsrecht gegen Dritte, das dem Aktionär durch zahlreiche Maßnahmen, die zur Beendigung des Unternehmensvertrags führen, entschädigungslos entzogen werden könne. Die Ausgleichsberechtigung sei auch keine der Verkehrsfähigkeit der Aktie vergleichbare Eigenschaft, die dem Aktieneigentum auf Dauer anhaften würde und deshalb verfassungsrechtlich schutzbedürftig wäre. Die in der Zukunft möglichen Ausgleichszahlungen seien ̶ ebenso wie Dividenden ̶ lediglich Chancen bzw. Verdienstmöglichkeiten, die von Artikel 14 Abs. 1 GG nicht geschützt seien.
Der Barwert der Ausgleichszahlungen sei auch nicht mit dem Börsenkurs vergleichbar: Während der Börsenwert durch Angebot und Nachfrage im Rahmen des Handels an der Börse bestimmt werde, sei der Barwert des Ausgleichs kein durch Angebot und Nachfrage gebildeter Preis, zu dem die Aktie tatsächlich verkauft werden könnte. Er sei vielmehr ein unter der Prämisse einer unendlichen Laufzeit des Unternehmensvertrags rechnerisch ermittelter Kapitalwert möglicher künftiger Zuflüsse, der als einer von mehreren Faktoren Einfluss auf den Börsenwert haben könne.
Einstweiliger Rechtsschutz gegen einen Einziehungsbeschluss
OLG Jena, Urteil vom 24. August 2016 – 2 U 168/16
Die Gesellschafterversammlung der Verfügungsbeklagten, eine GmbH, beschloss den Ausschluss des Verfügungsklägers aus der Gesellschaft. Die gegen diesen Beschluss erhobene Anfechtungsklage hatte Erfolg und wurde rechtskräftig. Noch während des vorgenannten Verfahrens beschloss die Gesellschafterversammlung der GmbH erneut, den Verfügungskläger aus der Gesellschaft auszuschließen. Am gleichen Tag beschloss sie die Umwandlung der GmbH in eine AG, die zwischenzeitlich auch ins Handelsregister eingetragen wurde. Auch gegen den erneuten Ausschluss- und Einziehungsbeschluss erhob der Verfügungskläger Beschlussanfechtungsklage, über die bislang nicht abschließend entschieden worden ist. Bereits unmittelbar nach Eintritt der Rechtskraft des dem Verfügungskläger Recht gebenden (ersten) Beschlussanfechtungsverfahrens begehrte der Verfügungskläger den Erlass einer einstweiligen Verfügung, mit der der Verfügungsbeklagten auferlegt werden sollte, den Verfügungskläger bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über die gegen den zweiten Ausschließungsbeschluss erhobene Beschlussanfechtungsklage wie einen Gesellschafter zu behandeln, da der Beschluss wegen Fehlens eines wichtigen Grundes unwirksam sei. Das LG Mühlhausen erließ eine entsprechende einstweilige Verfügung.
Das OLG Jena kam zu dem Ergebnis, dass die einstweilige Verfügung zu Unrecht erlassen wurde. Die Zulässigkeit einer einstweiligen Verfügung mit dem Ziel, einen ausgeschlossenen Gesellschafter bis zur Rechtskraft der Entscheidung über eine Anfechtungsklage gegen den Ausschließungsbeschluss wie einen Gesellschafter zu behandeln, setze voraus, dass der Ausschließungsbeschluss mit hoher Wahrscheinlichkeit unwirksam sei und ohne dessen Suspendierung dem betroffenen Gesellschafter konkrete, wesentliche und nicht wiedergutzumachende Nachteile drohten. Das war aus Sicht des OLG Jena vorliegend nicht der Fall. Zwar begründe das rechtskräftige Urteil, in dessen Rahmen einige der Umstände, die von der Verfügungsbeklagten für eine Ausschließung angeführt wurden, als nicht ausreichend gewichtige Pflichtverletzungen bewertet wurden, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass auch der erneut beschlossenen Ausschließung ein hinreichend gewichtiger Grund fehle. Indes habe die Verfügungsbeklagte die von ihr beschlossene Ausschließung auf weitere Sachverhalte gestützt, die bei der rechtlichen Beurteilung des ersten Ausschließungsbeschlusses noch nicht zu berücksichtigen gewesen waren. Ob diese Umstände für sich allein geeignet gewesen wären, die zweite Beschlussfassung als wirksam zu bewerten, sei in dem Verfügungsverfahren nicht umfänglich zu prüfen. Jedenfalls stünden diese Umstände der Würdigung entgegen, der gefasste Beschluss sei mit der für eine Leistungsvergütung notwendigen hohen Wahrscheinlichkeit unwirksam.
Der Verfügungskläger kann sich aus Sicht des OLG Jena auch nicht mit Erfolg darauf berufen, ihm drohten ohne die Suspendierung des Ausschließungs- und Einziehungsbeschlusses konkrete wesentliche und nicht wiedergutzumachende Nachteile. Zwar könne der Verfügungskläger aufgrund des von der Gesellschafterversammlung gefassten Beschlusses wesentliche Mitverwaltungsrechte nicht mehr ausüben. Dieser Nachteil sei jedoch in der vom gesetzlichen Leitbild abweichenden und im Zeitpunkt der Beschlussfassung maßgeblichen Satzung der Verfügungsbeklagten angelegt. In dieser hätten sich die Gesellschafter bewusst dafür entschieden, dass die Einziehung sofort und mit Bekanntgabe des Beschlusses wirksam werden solle. Die damit verbundene Inkaufnahme der den betroffenen Gesellschafter treffenden Nachteile sei vom Gericht zu respektieren. Aufgrund der beschlossenen Einziehung des Geschäftsanteils, die sofort wirksam wurde, sei die Gesellschafterliste der Verfügungsbeklagten vor der eingetragenen formwechselnden Umwandlung bis zur Aufhebung des Ausschließungs- und Einziehungsbeschlusses zutreffend gewesen. Etwaigen Rechtsnachteilen, die hieraus erwachsen, müsse der Verfügungskläger mit Rechtsbehelfen begegnen, die sich gegen die Gesellschafterliste bzw. seit der formwechselnden Umwandlung den Inhalt des Aktienregisters (§ 67 AktG) richten. Insoweit obliege es dem Verfügungskläger nach der formwechselnden Umwandlung und dem rechtskräftigen Abschluss des gegen den Einziehungsbeschluss gerichteten Rechtsstreits, seine Eintragung in das Aktienregister der Beklagten herbeizuführen, wenn die damals beschlossene Einziehung seines Geschäftsanteils unwirksam war.
Beschlussfeststellungsbefugnis und Stimmverbot bei Prokuraerteilung an Gesellschafter
OLG München, Urteil vom 12. Januar 2017 – 23 U 1994/16
Im vorliegenden Verfahren streiten zwei Gesellschafterfamilien über die Wirksamkeit verschiedener Gesellschafterbeschlüsse, insbesondere über die Reichweite eines etwaigen Stimmverbots.
Die Beklagte 1, eine GmbH, ist Komplementärin der Beklagten 2, einer GmbH & Co. KG. Die Klägerin und S. sind an der Beklagten 1 jeweils mit 25,2 % als Gesellschafter, an der Beklagten 2 ebenfalls mit je 25,2 % als Kommanditisten beteiligt. Ihre Väter sind als Gesellschafter an der Beklagten 1 mit jeweils 24,8 %, an der Beklagten 2 über Beteiligungsgesellschaften jeweils zu 24,8 % beteiligt. Die Klägerin sowie S. waren bis zu ihrer Abberufung aus wichtigem Grund im September 2008 Geschäftsführer der Beklagten 1. Zwischen den beiden Gesellschafterfamilien besteht seit vielen Jahren Streit. Im Rahmen eines Vergleichsschlusses im Juni 2013 wurde in der Satzung der Beklagten 1 ein Recht der Gesellschafterfamilien aufgenommen, für den ihnen jeweils zugewiesenen Geschäftsbereich einen Geschäftsführer zu entsenden. Die Entsendung der Gesellschafter selbst war ausdrücklich ausgeschlossen. Des Weiteren ist jede Gesellschafterfamilie berechtigt, ab Anfang 2015 für ihren Geschäftsbereich jeweils einen Prokuristen zu benennen, der von dem für diesen Geschäftsbereich zuständigen Geschäftsführer zu bestellen ist. Ob auch Gesellschafter als Prokuristen benannt werden dürfen, ist nicht ausdrücklich geregelt. S. wurde auf dieser Grundlage als weiterer Prokurist benannt, der damalige Geschäftsführer G. erteilte S. im Juni 2015 Einzelprokura für die Beklagte 1 und meldete dies zur Eintragung ins Handelsregister an. In einer gemeinsamen Gesellschafterversammlung der Beklagten 1 und 2 im Juli 2015 wurde über Beschlussanträge zur Geltendmachung von Schadensersatz- und Unterlassungsansprüchen gegen den damaligen Geschäftsführer G. und S. im Zusammenhang mit der Prokuraerteilung (Beschluss 1) sowie im Zusammenhang mit dem fremdgesteuerten Geschäftsführungshandeln des G. (Beschluss 2) und über die Bestellung von B. als besonderen Vertreter gemäß § 46 Nr. 8 GmbHG hierfür (Beschluss 3) abgestimmt. Ein weiterer Beschlussantrag sah vor, B. als weiteren Geschäftsführer anzuweisen, S. die erteilte Prokura zu entziehen und das Erlöschen der Prokura zum Handelsregister anzumelden (Beschluss 4). Bezüglich der genannten Tagesordnungspunkte stimmten jeweils die Gesellschafter der einen Familie für den Beschlussantrag, die Gesellschafter der anderen Familie dagegen. S. stellte als Versammlungsleiter jeweils fest, die Beschlussanträge seien abgelehnt worden. Die Klägerin ist der Ansicht, die Benennung von S. als Prokurist verstoße gegen die Satzung und sei treuwidrig. Den Gesellschaftern der Familie S. hätte jeweils bei den Beschlussanträgen kein Stimmrecht zugestanden. Das LG Landshut gab der Klage lediglich teilweise im Hinblick auf die Anweisung des B., dem S. die Prokura zu entziehen, statt.
Das OLG München stellte im Zusammenhang mit der Zulässigkeit der Klage zunächst fest, dass S. als Versammlungsleiter grundsätzlich zur Beschlussfeststellung befugt war. Die Frage, ob ein Versammlungsleiter bei einer unmittelbaren Selbstbetroffenheit durch den fraglichen Beschluss von einer verbindlichen Beschlussfeststellung ausgeschlossen ist, verneinte das OLG München in Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung. Der Versammlungsleiter habe zwar Einfluss auf den Gang der Versammlung und die Feststellung des Beschlussergebnisses. Jedoch habe er bei der Beschlussfeststellung ̶ anders als bei einer Stimmabgabe in der Sache ̶ gerade kein eigenes Ermessen, sondern sei an die gesetzlichen Regelungen gebunden. Verstoße er gegen diese, könnten die übrigen Gesellschafter die Wirksamkeit der festgestellten Beschlüsse durch Anfechtungs- und Nichtigkeitsfeststellungsklagen nachprüfen lassen. Damit würden die übrigen Gesellschafter auch nicht unzumutbar belastet. Zudem sei die Frage, ob der Versammlungsleiter in der Sache tatsächlich einem Stimmverbot unterliegt, häufig unklar und umstritten. Hinge die Beschlussfeststellungskompetenz aber jeweils davon ab, ob ein Stimmverbot besteht, würde letztlich schon die prozessuale Frage nach der richtigen Klageart unnötig mit Unsicherheiten verbunden und letztlich mit der materiellen Frage nach dem Stimmrechtsausschluss wegen Richtens in eigener Sache vermengt.
Im Hinblick auf die Entscheidung zur Geltendmachung von Schadensersatz- und Unterlassungsansprüchen gegen S. wegen der Prokuraerteilung an ihn (Beschluss 1) ist die Anfechtungsklage aus Sicht des OLG München auch begründet. S. habe bei der Beschlussfassung nach § 47 Abs. 4 S. 2 GmbHG kein Stimmrecht gehabt. Nach dieser Vorschrift sei das Stimmrecht nicht nur ausgeschlossen, wenn es um die Einleitung eines Rechtsstreits gegen einen Gesellschafter gehe, sondern auch schon, wenn es um die außergerichtliche Geltendmachung und Klärung von Ansprüchen gegen den Gesellschafter gehe. Da es vorliegend um die Ansprüche wegen der nach Ansicht der Klägerin pflichtwidrigen Prokuraerteilung durch G. an S. und das Handeln von G. „auf Order“ von S. geht, sei der Gesellschafter S. insgesamt vom Stimmrecht ausgeschlossen und der Beschluss mit den Stimmen der anderen Gesellschafterfamilie wirksam gefasst worden.
Im Hinblick auf die Geltendmachung von Schadensersatz- und Unterlassungsansprüchen gegen G. und S. im Zusammenhang mit dem fremdgesteuerten Geschäftsführungshandeln des G. (Beschluss 2) fehlt es aus Sicht des OLG München dagegen an einem hinreichend klar umrissenen Sachverhalt, aus dem sich Ansprüche ergeben könnten. Ein wirksamer Beschluss dahingehend wurde demnach nicht gefasst. Gehe es um die gerichtliche Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Gesellschafter und Geschäftsführer, reiche es grundsätzlich aus, dass der die Abstimmung beantragende Gesellschafter im Einzelnen umreiße, worin die Pflichtverletzung und der Tatbeitrag der einzelnen Mitgesellschafter bestehe. Ob der Prozess tatsächlich Aussicht auf Erfolg hat, sei nicht zu prüfen. Die maßgeblichen Vorfälle müssten im wesentlichen Kern benannt und der Anspruch identifizierbar bezeichnet sein. Die Höhe eines etwaigen Schadens müsse hierfür aber nicht benannt werden. Vorliegend ist aus Sicht des OLG München aus dem Beschlusstext selbst nicht erkennbar, welches konkrete Verhalten von G. und S. als pflichtwidrig angesehen wird und Schadensersatz- oder Unterlassungsansprüche auslösen soll.
Der Beschluss hinsichtlich der Bestellung von B. als besonderem Vertreter für die Geltendmachung von Ansprüchen aufgrund der Prokuraerteilung an S. (Beschluss 3) ist nach Ansicht des OLG München wirksam zustande gekommen. Ein besonderer Vertreter nach § 46 Nr. 8, 2. Alt GmbHG könne nicht nur für Prozesse gegen Geschäftsführer bestellt werden, sondern ebenso, wenn die Gesellschaft ̶ wie hier ̶ auch Ansprüche gegen Gesellschafter durchsetzen will, die zwar nicht Geschäftsführer sind, aber wegen einer Pflichtverletzung gemeinsam mit einem Geschäftsführer in Anspruch genommen werden sollen. Dabei könne ein Beschluss nach § 46 Nr. 8, 2. Alt GmbHG auch gefasst werden, wenn ein für die Vertretung geeigneter Geschäftsführer vorhanden sei und es um Verfahren gegen ehemalige Geschäftsführer gehe. S. habe entsprechend § 47 Abs. 4 S. 2 GmbHG bei der Beschlussfassung kein Stimmrecht gehabt. Der Stimmrechtsausschluss des wegen einer Pflichtverletzung in Anspruch zu nehmenden Gesellschafters gelte ebenso, wenn es darum gehe, nach § 46 Nr. 8 GmbHG einen besonderen Vertreter zu bestellen, der die Gesellschaft im Prozess gegen den Gesellschafter vertreten soll. Von dem betroffenen Gesellschafter könne nicht erwartet werden, dass er einen Prozessvertreter auswählt und bestellt, der gegen ihn selbst die Interessen der Gesellschaft am entschiedensten vertritt. Auf die Erfolgsaussichten des geplanten Vorgehens komme es für den Stimmrechtsausschluss nicht an.
Im Hinblick auf den Beschlussantrag, dem S. die erteilte Prokura zu entziehen und das Erlöschen der Prokura zum Handelsregister anzumelden (Beschluss 4), stellte das OLG München abschließend fest, dass dieser wirksam abgelehnt wurde. S. habe sein Stimmrecht ausüben dürfen. Bei einer Beschlussfassung nach § 46 Nr. 7 GmbHG über die Erteilung von Prokura an einen Gesellschafter sei dieser stimmberechtigt. Es handele sich insoweit, ähnlich der Bestellung eines Gesellschafters zum Geschäftsführer, um einen Organisationsakt, sodass ein Stimmverbot nach § 47 Abs. 4 GmbHG nicht besteht. Werde mit der Entscheidung über den Entzug der einem Gesellschafter erteilten Prokura die Gesellschafterversammlung befasst, gelten die gleichen Grundsätze wie bei der Abberufung eines Geschäftsführers. Ein Stimmverbot bestehe dann nur, wenn der Entzug der Prokura auf eine Pflichtverletzung des Gesellschafters als Prokuristen gestützt wird. S. habe daher vorliegend wirksam gegen den Beschlussantrag gestimmt. Die Stimmabgabe von S. und dem weiteren Gesellschafter der Familie S. sei auch nicht treuwidrig gewesen. Der Grundsatz, dass jeder Gesellschafter nur in eng begrenzten Ausnahmefällen sein Stimmrecht in einer bestimmten Weise auszuüben habe, sei von allgemeiner Gültigkeit. Vorliegend käme daher eine aus der gesellschafterlichen Treuepflicht abzuleitende Pflicht der beiden genannten Gesellschafter, dem Beschlussantrag zuzustimmen, allenfalls in Betracht, wenn die Rechtslage völlig eindeutig wäre, dass die Benennung von S. einen klaren und offensichtlichen Verstoß gegen die Satzung dargestellt hätte. Dies sei jedoch nicht der Fall.
Insolvenzrechtliche Anfechtbarkeit von Entnahmen eines Kommanditisten
OLG Schleswig-Holstein, Urteil vom 8. Februar 2017 – 9 U 84/16
Die Klägerin ist Insolvenzverwalterin über das Vermögen einer GmbH & Co. KG. Die Beklagte ist Kommanditistin der Insolvenzschuldnerin und zugleich ̶ mit einem Anteil von 98 % ̶ Gesellschafterin ihrer Komplementärin. Unter dem Gesichtspunkt der Insolvenzanfechtung nimmt die Klägerin die Beklagte auf Rückgewähr von Zahlungen an diese über insgesamt knapp EUR 14.000 in Anspruch. Die Parteien streiten darüber, ob die Beklagte als Kommanditistin der Schuldnerin berechtigt gewesen war, Privatentnahmen in genannter Höhe zu tätigen und die von ihr geschuldeten Krankenversicherungsbeiträge aus dem Vermögen der Schuldnerin zu begleichen. Im Gesellschaftsvertrag der Schuldnerin ist geregelt, dass die Kommanditeinlagen gleichzeitig feste Kapitalanteile sind, die nur durch Gesellschaftsvertrag geändert werden können. Die Einlage wird auf einem festen Kapitalkonto verbucht, das für jeden Kommanditisten die Beteiligung am Festkapital und am Gesellschaftsvermögen ausweist. Daneben sieht der Gesellschaftsvertrag für jeden Kommanditisten ein variables Kapitalkonto vor, auf dem Gewinn- und Verlustanteile sowie Entnahmen verbucht werden. Kommanditisten dürfen von ihrem variablen Kapitalkonto, sofern dieses einen aktiven Bestand ausweist, bis zu 10.000,00 DM (5.112,92 €) monatlich entnehmen. Das variable Kapitalkonto der Beklagten wies zum Zeitpunkt der Auszahlungen einen Saldo zu ihren Gunsten in Höhe von über EUR 100.000 aus. Die Parteien sind nicht einig darüber, ob die Salden richtig sind. Das LG Itzehoe hat der Klage auf Rückgewähr der Zahlungen unter dem Gesichtspunkt der Schenkungsanfechtung nach § 134 Abs. 1 InsO stattgegeben. Der Unentgeltlichkeit stehe das von der Beklagten geltend gemachte Entnahmerecht nicht entgegen. Die insoweit darlegungs- und beweisbelastete Beklagte habe schon nicht widerspruchsfrei zu einer entsprechenden Berechtigung nach dem Inhalt des Gesellschaftsvertrags vorgetragen. Im Übrigen hätte ein Guthaben auf dem variablen Kapitalkonto in der Krise der Schuldnerin wie ein Eigenkapital ersetzendes Darlehen behandelt werden müssen, sodass die streitgegenständlichen Auszahlungen jedenfalls gemäß § 135 InsO der Anfechtung unterlägen.
Das OLG Schleswig-Holstein verneinte eine Anfechtungsmöglichkeit der klagenden Insolvenzverwalterin. Es verneinte zunächst eine Anfechtungsmöglichkeit wegen unentgeltlicher Leistung nach § 134 Abs. 1 InsO. Die Darlegungs- und Beweislast für die Unentgeltlichkeit der Leistung im Sinne des § 134 Abs. 1 InsO trage die Insolvenzverwalterin. Diese hätte demzufolge darlegen und beweisen müssen, dass das von der Beklagten durch einen Buchhaltungsbeleg ausgewiesene Guthaben auf dem variablen Kapitalkonto unrichtig gewesen sei und in Höhe der jeweils getätigten Entnahmen tatsächlich nicht bestand. Die Klägerin habe lediglich das Guthaben bestritten, womit sie aber ihrer Darlegungs- und Beweislast nicht ausreichend nachgekommen sei.
Auch eine Anfechtung nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO komme nicht in Betracht: Der Saldo auf dem variablen Kapitalkonto sei als zum Eigenkapital der Insolvenzschuldnerin gehörende Beteiligung der Beklagten anzusehen und nicht als Forderung der Beklagten gegen die Insolvenzschuldnerin. Würden Gelder auf einem Kapitalkonto des Kommanditisten verbucht, könne dadurch eine Beteiligung des Gesellschafters an der Gesellschaft ausgewiesen oder eine Forderung des Gesellschafters gegenüber der Gesellschaft zum Ausdruck gebracht werden. Maßgebliche Bedeutung bei der Auslegung komme dabei dem Umstand zu, ob Verluste das Konto belasten dürfen oder ob sie von einem anderen Kapitalkonto abzusetzen oder einem Verlustsonderkonto zuzuschreiben sind. Wenn spätere Verluste abgesetzt werden können, handele es sich im Regelfall nicht um eine unentziehbare Forderung und es bleibe nur die Annahme einer Beteiligung. Weitere Auslegungskriterien (Verzinsung; Entnahmerecht; Bezeichnung des Kontos etc.) kämen erst zweitrangig zum Tragen. Vorliegend würden nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrags auf dem hier maßgeblichen variablen Kapitalkonto auch Verluste verbucht. Damit seien die streitgegenständlichen Zahlungen aus dem Eigenkapital der Insolvenzschuldnerin erfolgt. Auf Eigenkapitalausschüttungen sei § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO jedoch nicht anwendbar. Eine direkte Anwendung von § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO scheide im Falle der Ausschüttung von Eigenkapital schon deshalb aus, weil es nicht nur an einer einem Gesellschafterdarlehen gleichgestellten Forderung fehle, sondern überhaupt an einem Forderungsrecht des Gesellschafters. Unverzichtbares Wesensmerkmal eines Forderungsrechts sei die Unentziehbarkeit. Die Beteiligung eines Gesellschafters am Eigenkapital der Gesellschaft könne jedoch durch Verluste jederzeit aufgezehrt werden. Mache folglich ein Kommanditist von einem gesellschaftsvertraglichen Recht zur Entnahme aus dem Eigenkapital der Gesellschaft keinen Gebrauch, lasse er keine Forderung stehen, sondern begründe eine solche gar nicht erst. Auch eine entsprechende Anwendung von § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO kommt mangels planwidriger Regelungslücke aus Sicht des OLG Schleswig-Holstein nicht in Betracht. Gesetzgeberisches Ziel der Neufassung des § 135 InsO mit dem MoMiG sei eine Neuregelung des Rechts der Gesellschafterdarlehen gewesen. Die Unterscheidung von „kapitalersetzenden“ und „normalen“ Gesellschafterdarlehen sei ausdrücklich aufgegeben, das wertausfüllungsbedürftige Merkmal der Krisenfinanzierung durch eine einfach handhabbare Fristenregelung ersetzt worden. Der Gesetzgeber habe demnach eine insolvenzanfechtungsrechtliche Lösung der Gesellschafterfremdfinanzierung und keine Ausweitung des Eigenkapitalschutzes gewollt. Dass § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO direkt nicht auf Eigenkapitalausschüttungen anwendbar ist, laufe dem Plan des Gesetzgebers deshalb nicht zuwider.
Letztlich seien die im Streit stehenden Zahlungen mangels Vorliegen der subjektiven Voraussetzungen der Vorsatzanfechtung auch nicht nach § 133 Abs. 1 InsO anfechtbar. Eine Vermutung der Kenntnis der Beklagten von einer (etwaigen) Zahlungsunfähigkeit nach § 138 Abs. 2 Nr. 1 InsO oder § 138 Abs. 2 Nr. 3 InsO konnte nicht zur Überzeugung des Gerichts angenommen werden. Zwischen den Parteien sei im Streit, ob und falls ja inwieweit die Beklagte als Kommanditistin der Schuldnerin, Gesellschafterin der Komplementärin und als Lebensgefährtin des Geschäftsführers der Komplementärin der Insolvenzschuldnerin Einsicht in deren Geschäftsvorgänge hatte. Näheren Vortrag der Klägerin hierzu gebe es nicht. Eine Einsicht in die für die Beurteilung einer Zahlungsunfähigkeit maßgeblichen Geschäftsvorgänge (die ihrerseits nicht näher dargelegt sind) sei auch sonst nicht ersichtlich.
Wettbewerbsverbot eines Gesellschafter-Geschäftsführers
OLG Stuttgart, Urteil vom 15. März 2017 – 14 U 3/14
Die Klägerinnen machen mit ihrer Klage Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüche geltend, die auf einen Verstoß des Beklagten ̶ ehemaliger Gesellschafter-Geschäftsführer der Klägerin 1 ̶ gegen ein insbesondere aus dem Gesellschaftsvertrag abgeleitetes Wettbewerbsverbot gestützt werden. Der Beklagte war mit 49 % an der Klägerin 1 beteiligt und deren einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer. Die Klägerin 1 ist die deutsche Vertriebsgesellschaft der Klägerin 2. Der Gesellschaftsvertrag der Klägerin 1 sieht für den Fall der Kündigung der Gesellschaft durch einen Gesellschafter die Fortsetzung der Gesellschaft sowie die Verpflichtung des kündigenden Gesellschafters vor, dessen Geschäftsanteile gegen eine Abfindung entweder an die Gesellschaft oder einen anderen Gesellschafter zu veräußern. Zur Bewertung des Geschäftsanteils für die zu zahlende Abfindung soll das „Stuttgarter Verfahren“ herangezogen werden. Auch enthält der Gesellschaftsvertrag ein Wettbewerbsverbot, nach dem ein Gesellschafter, solange er Gesellschafter ist, der Gesellschaft in deren Geschäftszweig weder mittelbar noch unmittelbar, gelegentlich oder gewerbsmäßig Konkurrenz machen, noch sich an einem Konkurrenzunternehmen beteiligen darf. Nachdem es zwischen den Parteien zum Streit gekommen war, kündigte der Beklagte seine Gesellschaftsbeteiligung. Bereits einen Monat vor der Kündigung erwarb der Beklagte über eine Treuhandkonstruktion mittelbar eine Beteiligung in Höhe von 12 % am Aktienkapital einer im selben Geschäftsbereich wie die Klägerin 1 tätigen Gesellschaft. Die Klägerinnen machen einen Verstoß des vorgenannten Wettbewerbsverbots durch den Beklagten geltend. Widerklagend macht der Beklagte Wettbewerbsverstöße der Klägerinnen geltend und verlangt die Zahlung einer ihm infolge seines Ausscheidens als Gesellschafter zustehenden Abfindung. Das LG Stuttgart hat die Klage in erster Instanz abgewiesen und der Widerklage im Hinblick auf die Zahlung der Abfindung stattgegeben.
Das OLG Stuttgart folgte den erstinstanzlichen Urteilen weitgehend. Der Beklagte habe durch den Erwerb der Minderheitsbeteiligung nicht gegen das ihn als Gesellschafter-Geschäftsführer treffende gesetzliche und das gesellschaftsvertragliche Wettbewerbsverbot verstoßen. Rein kapitalistische Minderheitsbeteiligungen eines Gesellschafter-Geschäftsführers an einer Konkurrenzgesellschaft ohne Einfluss auf deren Geschäftsführung, ohne Tätigkeit im Unternehmen und ohne Möglichkeit, dieses zu beherrschen oder Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen zu nehmen, seien im Regelfall unbedenklich und von der sachlichen Reichweite eines Wettbewerbsverbots des Gesellschafter-Geschäftsführers nicht umfasst. Unter solchen Umständen könne ein Wettbewerbsverbot seiner Ratio nach nicht eingreifen. Zweck des Wettbewerbsverbots zu Lasten eines Gesellschafter-Geschäftsführers sei es, dass dieser seine aus der Gesellschafterstellung erlangten Kenntnisse oder seinen auf der Gesellschafterstellung beruhenden Einfluss nicht dazu verwendet, die eigenen Geschäfte zum Nachteil der Gesellschaft zu fördern. Zudem solle das Wettbewerbsverbot sicherstellen, dass die Arbeitskraft des Geschäftsführers für die Gesellschaft erhalten bleibe. Nichts dergleichen stehe regelmäßig bei einer rein kapitalistischen Minderheitsbeteiligung in Rede. Dass die vom Beklagten erworbene Beteiligung am Konkurrenzunternehmen über eine rein kapitalistische Minderheitsbeteiligung hinausgehe, hätten die Klägerinnen nicht vorgetragen. Gleiches gelte für das im Gesellschaftsvertrag vorgesehene Wettbewerbsverbot. Grundsätzlich müsse eine gesellschaftsvertragliche Regelung oder eine Regelung im Anstellungsvertrag, die ein Wettbewerbsverbot des Gesellschafter-Geschäftsführers vorsieht, im Lichte von Artikel 12 Abs. 1 GG ausgelegt werden. Sie erfasse ihrem rechtlich unbedenklichen Sinn und Zweck nach, die Gesellschaft vor der Aushöhlung von innen her zu schützen, im Regelfall nicht den rein kapitalistischen Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an einem Konkurrenzunternehmen und sei entsprechend einschränkend auszulegen.
Ansprüche des Beklagten gegen die Klägerinnen aufgrund eines Wettbewerbsverstoßes durch Erwerb einer Beteiligung an einem Konkurrenzunternehmen lehnte das OLG Stuttgart mangels Aktivlegitimation des Beklagten ab. Die geltend gemachten Ansprüche aus dem im Gesellschaftsvertrag der Klägerin 1 verankerten Wettbewerbsverbot stünden nicht dem Beklagten, sondern allenfalls der Klägerin 1 zu, die aus einem ihre Gesellschafter bzw. Geschäftsführer ggf. treffenden Wettbewerbsverbot berechtigt ist. Einem Minderheitsgesellschafter könnten eigene Ansprüche aus der Verletzung eines gesellschaftsvertraglichen Wettbewerbsverbots durch einen Mitgesellschafter nur dann zustehen, wenn er einen über den durch die Minderung des Gesellschaftsvermögens im Wert seines Geschäftsanteils eingetretenen Reflexschaden hinausgehenden eigenen Schaden erlitten habe. Hierzu habe der Beklagte jedoch nichts vorgetragen. Die in Frage stehende Rechtsverfolgung habe gegenüber der Klägerin 1 darüber hinaus schon deswegen von vornherein keinen Erfolg, weil die Klägerin 1 allenfalls aus dem Wettbewerbsverbot berechtigt sein könne, nicht aber verpflichtet. Im Übrigen sei nichts dafür ersichtlich oder vorgetragen, dass und ggf. wie die Klägerin 1 an den angeblichen Wettbewerbsverstößen beteiligt gewesen sein sollte.
Die Höhe des Abfindungsanspruchs hat das LG Stuttgart aus Sicht des OLG Stuttgart zutreffend festgelegt. Eine im Gesellschaftsvertrag enthaltene Klausel, wonach eine anlässlich des Ausscheidens eines Gesellschafters zu leistende Abfindung nach dem im sogenannten „Stuttgarter Verfahren“ ermittelten Wert seines Anteils berechnet wird, sei grundsätzlich wirksam und für die Parteien verbindlich. Die gesetzliche Lage hinsichtlich einer Festlegung einer Abfindung nach dem vollen wirtschaftlichen Wert der Beteiligung sei im Grundsatz dispositiv und die hier einschlägigen gesellschaftsvertraglichen Regelungen vorbehaltlich sich aus dem objektiven Recht ggf. ergebender Wirksamkeitsschranken grundsätzlich von der Vertragsfreiheit gedeckt. Vorliegend habe der beauftragte Sachverständige für die Parteien den Anteilswert im Rahmen eines nicht offenbar unrichtigen Schiedsgutachtens verbindlich festgelegt.
Zwar könne eine gesellschaftsvertragliche Abfindungsregelung, die an eine Anteilsbewertung nach dem „Stuttgarter Verfahren“ anknüpft, im Einzelfall unanwendbar und der Abfindungsbetrag anzupassen sein, wenn der sich nach dem „Stuttgarter Verfahren“ ergebende Anteilswert vom tatsächlichen Verkehrswert des Anteils erheblich abweicht. Das gilt nach Ansicht des OLG Stuttgart auch dann, wenn der tatsächliche Verkehrswert deutlich niedriger liegt als der nach dem „Stuttgarter Verfahren“ ermittelte Anteilswert. Ein solches Missverhältnis konnte das OLG Stuttgart vorliegend jedoch nicht feststellen.
Aufsichtsratsergänzung einer mitbestimmten Aktiengesellschaft
OLG Stuttgart, Beschluss vom 24. Februar 2017 – 20 W 8/16
Gegenstand des Verfahrens ist die gerichtliche Ergänzung der Arbeitnehmerbank des Aufsichtsrats einer paritätisch mitbestimmten AG mit einem „Vertreter von Gewerkschaften“ im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 3 MitbestG. Von den zehn Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer sind sieben mit Arbeitnehmern der Gesellschaft und drei mit Vertretern von Gewerkschaften zu besetzen. Der Vorstand gemeinsam mit einer Gewerkschaft (IG Metall) und die Beschwerdeführerin, eine weitere Gewerkschaft (CGM), haben unterschiedliche Kandidaten zur gerichtlichen Ergänzungsbestellung benannt. Mit dem angefochtenen Beschluss hatte das AG Stuttgart die vom Vorstand gemeinsam mit der IG Metall beantragte Kandidatin nach § 104 AktG als Aufsichtsratsmitglied bestellt. Hiergegen richtet sich die Beschwerdeführerin mit der Begründung, das AG Stuttgart habe sein Ermessen hinsichtlich der Bestellung des Aufsichtsratskandidaten des Vorstands aus verschiedenen Gründen falsch ausgeübt.
Dieser Ansicht widersprach das OLG Stuttgart und wies die Beschwerde als unbegründet ab: In seiner eigenen Ermessensentscheidung folgte das OLG Stuttgart dem Ergebnis des AG Stuttgart im Hinblick auf das bestellte Ergänzungsmitglied. Sei ein Aufsichtsratsmitglied zu ersetzen, bei dessen Wahl eine Spitzenorganisation der Gewerkschaften, eine Gewerkschaft oder die Betriebsräte ein Vorschlagsrecht hätten, so solle das Gericht nach § 104 Abs. 4 S. 4 AktG Vorschläge dieser Stellen berücksichtigen, soweit nicht überwiegende Belange der Gesellschaft oder der Allgemeinheit der Bestellung des Vorgeschlagenen entgegenstünden. Stets habe das Gericht dabei von Amts wegen zu prüfen, ob der Vorschlag von einer Gewerkschaft oder einem Betriebsrat stammt, ferner ob die Gewerkschaft oder der Betriebsrat vorschlagsberechtigt sind. Liegen dem Gericht konkurrierende Vorschläge vorschlagsberechtigter Gremien vor, stehe es in seinem Ermessen, welchem der vorgeschlagenen Kandidaten es den Vorzug gibt und zum Aufsichtsratsmitglied bestellt. Nach verbreiteter Auffassung solle oder müsse das Gericht gar in einem solchen Fall die Person bestellen, die von dem zuständigen Gremium voraussichtlich bestellt worden wäre. Lasse sich nicht sagen, wie eine Wahl ausgehen würde, könne das Gericht zwischen den Vorschlägen frei wählen.
Dass eine Bestellung der Aufsichtsratskandidatin der IG Metall den sonstigen gesetz- und satzungsmäßigen Bestellungsvoraussetzungen entspricht, insbesondere die besonderen persönlichen Bestellungsvoraussetzungen nach § 104 Abs. 4 S. 3 AktG in ihrer Person gegeben sind, habe das AG Stuttgart zu Recht angenommen; entgegenstehende Anhaltspunkte seien weder ersichtlich noch von den Beteiligten aufgezeigt.
Ein Interessenkonflikt aufgrund eines weiteren Aufsichtsratsmandats der Kandidatin der IG Metall war aus Sicht des OLG Stuttgart nicht anzunehmen. Eine tatsächliche Konkurrenzlage beider Unternehmen sei auf der Grundlage der Faktenlage schon nicht festzustellen gewesen. Zusätzlich sei aber zu berücksichtigen, dass selbst die Wahrnehmung von Organtätigkeiten in einem Konkurrenzunternehmen nach überwiegender Ansicht in Rechtsprechung und Literatur kein Hindernis für die Bestellung als Aufsichtsrat darstellt. Anderes solle allenfalls bei einer Konkurrenzsituation gelten, welche dauerhaft die gesamte Tätigkeit und den wesentlichen Kernbereich der Unternehmen betrifft, und bei sonstigen schwerwiegenden Dauerkonflikten, von denen vorliegend nicht gesprochen werden könne. Begründe aber selbst die Wahrnehmung von Organtätigkeiten in einem Konkurrenzunternehmen kein Hindernis für die Bestellung in den Aufsichtsrat, gelte dies umso mehr in dem hier zur Entscheidung stehenden Fall, in dem es bereits für die Annahme einer „Konkurrenzlage“ zwischen der Gesellschaft und der weiteren Gesellschaft an einer nachvollziehbaren, belastbaren Grundlage fehle.
Auch die Tatsache, dass dem Aufsichtsrat der vorliegenden AG gleichzeitig auch der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, in dem die Kandidatin der IG Metall ebenfalls Aufsichtsratsmitglied ist, als Mitglied der Anteilseignerbank angehört, stand einer wirksamen Ermessensausübung ebenfalls nicht entgegen. Das OLG Stuttgart sah keinen konkreten Anhaltspunkt dafür, dass der Vorstandsvorsitzende des anderen Unternehmens von der Kandidatin angesichts deren Stellung als Aufsichtsratsmitglied bei dem weiteren Unternehmen abhängig sei und es dadurch zu einer faktischen Umkehrung des rechtlich gebotenen Übergewichts der Anteilseigner- zugunsten der Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat kommen könne. Allein aufgrund der für alle Aktiengesellschaften geltenden Kompetenzverteilung und der der Presse vage zu entnehmenden angeblichen Absichten des Vorstandsvorsitzenden des anderen Unternehmens für den hier in Rede stehenden Fall zu unterstellen, der Vorstandsvorsitzende sei in einer Art und Weise von der Kandidatin als Mitglied des Aufsichtsrats des anderen Unternehmens abhängig, dass darin ein ins Gewicht fallender Aspekt gegen die hier in Frage stehende Bestellung als Aufsichtsrätin der Gesellschaft gesehen werden könnte, sei nicht zulässig.
Dass die bestellte Kandidatin der IG Metall im Gegensatz zur Kandidatin der CGM nicht Arbeitnehmerin der AG sei, spreche entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch eher für die bestellte Kandidatin. Zu entscheiden sei hier gerade nicht über ein Aufsichtsratsmandat als „Arbeitnehmer“ im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 3 MitbestG, sondern über ein solches als „Vertreter von Gewerkschaften“ im Sinne dieser Vorschrift. In Bezug auf ein als „Vertreter von Gewerkschaften“ im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 3 MitbestG bestelltes Aufsichtsratsmitglied sei der von der Beschwerde unterstellte Vorrang eines der Arbeitnehmerschaft zugehörigen gegenüber einem externen Gewerkschaftsvertreter jedoch ohne Basis in der gesetzlichen Regelung. Die Regelung des § 7 Abs. 2 Nr. 3 MitbestG über die „Vertreter von Gewerkschaften“ als Aufsichtsratsmitglieder und insbesondere das korrespondierende Vorschlagsrecht der Gewerkschaften nach § 16 Abs. 2 MitbestG beruhen nicht zuletzt auf dem rechtspolitischen Grundanliegen, auch und gerade externen Arbeitnehmervertretern „zum Wohl des Unternehmens“ einen festen Platz in den Aufsichtsräten zu schaffen. Hiermit aber wäre die Annahme eines generellen Vorrangs eines der Arbeitnehmerschaft zugehörigen gegenüber einem externen Gewerkschaftsvertreter, wie ihn die Beschwerde annimmt, unvereinbar.
Eine Karenzzeit nach § 100 Abs. 2 Nr. 4 AktG habe die bestellte Kandidatin der IG Metall aufgrund ihrer zwischenzeitlich beendeten Aufsichtsratstätigkeit bei einer weiteren AG ebenfalls nicht einzuhalten gehabt. § 100 Abs. 2 Nr. 4 AktG beschränke den Wechsel vom Vorstand in den Aufsichtsrat und wolle dem Bedenken Rechnung tragen, dass das ehemalige Vorstandsmitglied den neuen Vorstand behindern und die Bereinigung strategischer Fehler oder die Beseitigung von Unregelmäßigkeiten aus der eigenen Vorstandszeit unterbinden könnte. Das sei für den hier zur Entscheidung stehenden Fall ersichtlich ohne Bedeutung gewesen.
Letztlich stellte das OLG Stuttgart klar, dass dem Aktiengesetz auch kein Auswahlkriterium dahingehend zu entnehmen sei, dass alle im Unternehmen vertretenen Gewerkschaften innerhalb der Arbeitnehmerbank des Aufsichtsrats repräsentiert sein müssen und deshalb der von der CGM vorgeschlagenen Kandidatin der Vorzug zu geben sei. Richtig sei zwar, dass das in §§ 10 Abs. 1, 16 Abs. 1 MitbestG verankerte Prinzip der Verhältniswahl einen gewissen Minderheitenschutz bewirke. Dieser lasse sich allerdings nicht zu dem von der Beschwerde gewünschten, bei der hier zu treffenden Entscheidung maßgebenden „Auswahlkriterium“ verdichten.
Pressemitteilung des OLG Stuttgart
Bestellung eines besonderen Vertreters für Ansprüche gegen Aktionäre
LG Heidelberg, Urteil vom 21. März 2017 – 11 O 11/16 (KfH)
Die Klägerin, eine nicht börsennotierte AG, macht gegen die Beklagten, zwei Aktionäre sowie zwei Vorstandsmitglieder und vier Aufsichtsratsmitglieder, Zahlungsansprüche in Höhe von insgesamt knapp EUR 16 Mio. wegen zu Unrecht erhaltener bzw. veranlasster Dividenden geltend. Die Hauptversammlung der Klägerin beschloss am 6. Oktober 2015 mehrheitlich die Geltendmachung der Ersatzansprüche. Auch wurde ein besonderer Vertreter für die Klägerin bestellt, der die Ansprüche gegen Aktionäre, Vorstand und Aufsichtsrat durchsetzen sollte.
Das LG Heidelberg wies die Klage als unzulässig ab, da die Klägerin durch den besonderen Vertreter nicht wirksam gesetzlich vertreten worden sei. Die Beschlüsse der Hauptversammlung der Klägerin vom 6. Oktober 2015 zur Bestellung des besonderen Vertreters seien im Hinblick auf die Ansprüche gegen die Aktionäre rechtswidrig und gemäß § 241 Nr. 3, 1. Alt. AktG nichtig.
Gemäß § 147 Abs. 2 S. 1 AktG könne die Hauptversammlung zur Geltendmachung eines Ersatzanspruchs gemäß § 147 Abs. 1 AktG einen besonderen Vertreter bestellen. Gemäß § 147 Abs. 1 AktG müssen Ersatzansprüche der Gesellschaft aus der Gründung gegen die nach den §§ 46-48, 53 AktG verpflichteten Personen oder aus der Geschäftsführung gegen die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats oder aus § 117 AktG geltend gemacht werden, wenn es die Hauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit beschließt. Hieraus folgt aus Sicht des LG Heidelberg, dass die Hauptversammlungsbeschlüsse den von § 147 AktG vorgegebenen rechtlichen Rahmen verlassen, soweit ein besonderer Vertreter ermächtigt wurde, Ansprüche der Klägerin gegen Aktionäre gemäß § 62 Abs. 1 AktG oder § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 20 Abs. 1 AktG geltend zu machen. Auch aus der systematischen Auslegung der Norm, wonach § 147 AktG als Ausnahmevorschrift von § 78 Abs. 1 AktG, wonach der Vorstand die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich vertritt, eng auszulegen ist, folge, dass ein besonderer Vertreter nicht ermächtigt werden kann, Ansprüche der Klägerin gegen die Aktionäre gemäß § 62 Abs. 1 AktG oder § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 20 Abs. 1 AktG geltend zu machen. Die Geltendmachung von Ansprüchen gemäß § 62 Abs. 1 AktG sei nach ganz herrschender Auffassung Sache des Vorstands.
Unter § 241 Nr. 3, 1. Alt. AktG sind insbesondere kompetenzüberschreitende Hauptversammlungsbeschlüsse zu fassen, namentlich solche, die in die Geschäftsführungszuständigkeit des Vorstands eingreifen. Kompetenzbegrenzende Vorschriften gehören aus Sicht des LG Heidelberg zum Strukturbild der Aktiengesellschaft, sodass Kompetenzüberschreitungen nicht als bloße Verfahrensfehler angesehen werden könnten. Durch die Ermächtigung eines besonderen Vertreters, Ansprüche der Klägerin gegen Aktionäre geltend zu machen, werde in die Kompetenz des Vorstands eingegriffen, der gemäß § 78 Abs. 1 AktG hierzu berufen sei. Diese Kompetenzüberschreitung wiege deshalb besonders schwer, weil gemäß § 147 AktG lediglich in eng umschriebenen Ausnahmefällen dem besonderen Vertreter Kompetenzen zugewiesen würden, während im Regelfall die Kompetenzen auf die Organe Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung in einer Aktiengesellschaft verteilt seien. Jedenfalls in der vorliegenden Fallkonstellation führe die Kompetenzüberschreitung der Hauptversammlungsbeschlüsse somit dazu, dass diese mit dem Wesen der Aktiengesellschaft nicht zu vereinbaren und demnach nichtig seien.
Aus der Teilnichtigkeit der Hauptversammlungsbeschlüsse, soweit der besondere Vertreter ermächtigt wurde, Ansprüche der Klägerin gegen die Aktionäre geltend zu machen, folgt gemäß § 139 BGB aus Sicht des LG Heidelberg, dass die Hauptversammlungsbeschlüsse insgesamt nichtig sind. Die Auslegung der Hauptversammlungsbeschlüsse ergebe, dass nach dem Beschlussinhalt ein innerer Zusammenhang zwischen der Ermächtigung des besonderen Vertreters, Ansprüche der Klägerin gegen die Aktionäre geltend zu machen, und seiner Ermächtigung, Ansprüche der Klägerin gegen die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder geltend zu machen, bestehe. Dies habe zur Folge, dass nicht anzunehmen sei, dass der besondere Vertreter durch die Hauptversammlung auch ermächtigt worden ist, ausschließlich Ansprüche der Klägerin gegen die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder geltend zu machen.
Auch aus den Grundsätzen der fehlerhaften Bestellung eines Organs folgt aus Sicht des LG Heidelberg nicht, dass der besondere Vertreter befugt wäre, die Klägerin (weiterhin) zu vertreten und das Klageverfahren fortzuführen. Zwar sei anerkannt, dass im Rahmen seines Aufgabenkreises der besondere Vertreter Organqualität mit der Folge besitzt, dass die Grundsätze der fehlerhaften Bestellung auch auf ihn anwendbar sind. Diese Grundsätze der fehlerhaften Bestellung führten jedoch lediglich dazu, dass die von dem besonderen Vertreter bis zur rechtswirksamen Feststellung der Nichtigkeit vorgenommenen Handlungen für die Gesellschaft gültig bleiben. Nach rechtswirksamer Feststellung der Nichtigkeit könne der besondere Vertreter auch nach den Grundsätzen der fehlerhaften Bestellung die Aktiengesellschaft nicht mehr wirksam vertreten. Erhebe ein besonderer Vertreter – wie vorliegend – für eine Aktiengesellschaft eine Klage, sei auf den Einwand der Beklagten, dass die ihn ermächtigenden Hauptversammlungsbeschlüsse nichtig seien, dies inzident während des Rechtsstreits zu prüfen. Anerkannt sei, dass die Nichtigkeit oder der ihr zu Grunde liegende Gesetzesverstoß nicht durch besondere Erklärung oder Klage geltend gemacht werden müsse, sondern dass sich jedermann in beliebiger Weise auf die Nichtigkeit berufen könne. Somit folge aus der Nichtigkeit der Hauptversammlungsbeschlüsse, dass die Klage als unzulässig abzuweisen ist, wenn das zuständige Organ nach erkannter Nichtigkeit dieser Beschlüsse den Schadensersatzprozess nicht aufnimmt und die Prozessführung des besonderen Vertreters nicht genehmigt. Obwohl der Vorstand ausweislich des Vortrags der beklagten Vorstandsmitglieder im hier anhängigen Rechtsstreit erkannt hat, dass die Hauptversammlungsbeschlüsse nichtig sind und die Klägerin durch ihren besonderen Vertreter nicht wirksam vertreten wird, hätten sie weder den Schadensersatzprozess gegen die Aktionäre aufgenommen noch die Prozessführung des besonderen Vertreters insoweit genehmigt. Vielmehr hätten sie sich während des laufenden Rechtsstreits dezidiert dahingehend eingelassen, dass sie die Klage gegen die beklagten Aktionäre auch für unbegründet hielten, weil die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche nicht bestünden. Zudem habe die Hauptversammlung der Klägerin auch keinen weiteren besonderen Vertreter wirksam bestellt, der die Prozessführung des bisherigen besonderen Vertreters hätte genehmigen können.
Pressemitteilung des LG Heidelberg
Ausgliederungsverbot gilt nicht bei Insolvenzplan
AG Norderstedt, Beschluss vom 7. November 2016 – 66 IN 226/15
Über das Vermögen eines Einzelkaufmanns war ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der Insolvenzplan sah einen Schuldenschnitt sowie die Ausgliederung des Einzelunternehmens zur Neugründung einer GmbH unter Veräußerung einer Mehrheitsbeteiligung zu Gunsten der Gläubiger vor. Das AG Norderstedt bestätigte den Insolvenzplan nach § 248 Abs. 1 InsO trotz des grundsätzlich hier einschlägigen Ausgliederungsverbots des § 152 S. 2 UmwG. Nach dieser Vorschrift kann eine Ausgliederung des von einem Einzelkaufmann betriebenen Unternehmens nicht erfolgen, wenn die Verbindlichkeiten des Einzelkaufmanns sein Vermögen übersteigen. Das Ausgliederungsverbot steht aus Sicht des AG Norderstedt der Ausgliederung eines von einem Einzelkaufmann betriebenen Unternehmens im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens aber nicht entgegen. Der Schutzzweck des Ausgliederungsverbotes gelte im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens nicht, weil die Insolvenz des Einzelkaufmanns gerade aufgedeckt und vom Insolvenzverwalter im Rahmen der Berichtspflicht offengelegt werde.