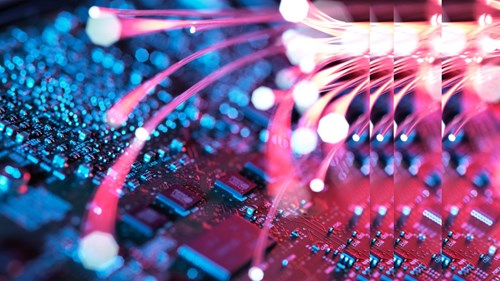Brexit: Die Übergangsphase endet - was sollten Sie wissen?
Nach dem offiziellen EU-Austritt des Vereinigten Königreichs zum 31.01.2020 lief am 31.12.2020 nun auch die Übergangsphase des Austritts ab, in der u. a. verschiedene Bestimmungen des EU-Kartellrechts fortgalten. Das jüngst abgeschlossene Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich enthält zwar u. a. gewisse Kooperationsbestimmungen für die Zusammenarbeit der Wettbewerbsbehörden der Länder. Dies ändert aber nichts daran, dass sich Unternehmen auf gewisse Änderungen einstellen sollten:
Fusionskontrolle
Für Unternehmenstransaktionen mit Bezug zum Vereinigten Königreich, die nach dem 31.12.2020 bei den Wettbewerbsbehörden angemeldet werden, gilt nicht länger das sogenannte One-Stop-Shop-Prinzip. Nach diesem Prinzip war die Europäische Kommission für Transaktionen, die die Umsatzschwellen der EU-Fusionskontrolle erreichten und daher eine EU-Dimension hatten, vollumfänglich zuständig. Dies galt auch, soweit die Transaktionen das Vereinigte Königreich betrafen. Nach Ablauf der Übergangsphase wird sich dies nun ändern und Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass die Wettbewerbsbehörde des Vereinigten Königreichs („CMA“) vermehrt Anmeldungen parallel zur Europäischen Kommission überprüfen wird.
Zukünftig ist außerdem bei der Prüfung, ob die Umsatzschwellen der EU-Fusionskontrolle erreicht werden, darauf zu achten, dass Umsätze aus dem Vereinigten Königreich nicht länger zu berücksichtigen sind. Da aber die Schwellenwerte der EU-Fusionskontrolle trotz des Austritts des Vereinigten Königreichs nicht nach unten angepasst wurden, könnten ab Januar 2021 weniger Transaktionen in den Anwendungsbereich der EU-Fusionskontrolle fallen als bisher. Dies kann dazu führen, dass vermehrt parallele Anmeldungen in den verbleibenden Mitgliedstaaten der EU notwendig werden, da die Schwellenwerte hier deutlich niedriger liegen als auf der EU-Ebene. Im Einzelfall kann aber über eine Verweisung an die Europäische Kommission nachgedacht werden.
Kartellverfahren
Soweit die Europäische Kommission bereits vor Ablauf der Übergangsphase ein Kartellverfahren eingeleitet hat, bleibt sie für dieses Verfahren zuständig. Hat die Europäische Kommission vor Ablauf der Übergangsphase kein Kartellverfahren betreffend eines Sachverhalts eingeleitet, der auch das Vereinigte Königreich betrifft, kann die CMA ein Verfahren einleiten und zwar unabhängig davon, ob das Verhalten vor oder nach dem 31.12.2020 stattgefunden hat. Wichtig ist allerdings, dass die Europäische Kommission gemäß dem Auswirkungsprinzip ebenfalls für das Fehlverhalten in solchen Fällen zuständig ist, wenn das betreffende Verhalten sich (neben dem Vereinigten Königreich) in der EU auswirkt. Auch im Bereich der Kartellverfahren müssen Unternehmen also zukünftig mit parallelen Verfahren und damit auch einer Erhöhung des Bußgeldrisikos rechnen.
Neben diesen ausgewählten Problemen stellen sich weitere praxisrelevante Fragen: Was gilt hinsichtlich der Bindungswirkung der Kartellentscheidungen der Europäischen Kommission bzw. der EU-Gerichte zukünftig im Vereinigten Königreich? Dieser Bindungswirkung für nationale Gerichte kommt aufgrund der mit ihr einhergehenden Beweislasterleichterung erhebliche Bedeutung in Kartellschadensersatzprozessen zu. Werden britische Gerichte eine solche Bindungswirkung zukünftig noch anerkennen oder sollte ein potentieller Schadensersatzkläger kartellrechtlichen Schadensersatz allein aus Gründen der Rechtssicherheit vorzugsweise in einem Mitgliedstaat der EU geltend machen?