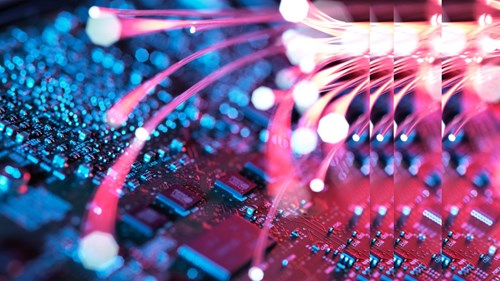Corporate-Newsletter März 2016
Rechtsprechung
Gewährung von Ausschüttungen in KG als Darlehen
BGH, Urteil vom 16. Februar 2016 – II ZR 348/14
Der Beklagte war Kommanditist der Klägerin, einer Publikumsgesellschaft. Ihr Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass „Ausschüttungen von Liquiditätsüberschüssen den Kommanditisten als unverzinsliche Darlehen gewährt werden, sofern die Ausschüttungen nicht durch Guthaben auf den Gesellschafterkonten gedeckt sind“. Die Klägerin erklärte unter Berufung auf diese Regelung des Gesellschaftsvertrags „die Kündigung der als unverzinsliche Darlehen gewährten Ausschüttungen“ und verlangte einen Teil der gewährten Ausschüttungen zurück.
Der BGH hat die Revision der Klägerin gegen das klageabweisende Urteil der Vorinstanz zurückgewiesen und einen Anspruch der Klägerin auf Rückzahlung von Ausschüttungen verneint. Zwischen den Parteien bestehe weder ein gesetzlicher Rückzahlungsanspruch, noch wurde ein separater Darlehensvertrag vereinbart. Insbesondere aus der dargestellten Regelung des Gesellschaftsvertrags ergebe sich kein Darlehensrückzahlungsanspruch. Dabei könne dahin stehen, ob die Regelung ausreichend klar bestimmt sei. Die Klausel sei jedenfalls deshalb unwirksam, weil sie für den Kommanditisten überraschend ist und diesen daher entgegen Treu und Glauben unangemessen benachteiligt. Sie hält daher einer Auslegung und Inhaltskontrolle nicht standhält.
Der BGH bestätigte seine ständige Rechtsprechung, wonach ein Rückzahlungsanspruch der klagenden Gesellschaft nicht schon dann entsteht, wenn an einen Kommanditisten von § 169 Abs. 1 HGB nicht gedeckte Auszahlungen zu Lasten seines Kapitalanteils geleistet werden. Dies gelte selbst dann, wenn die Auszahlung dessen Kapitalanteil unter die vereinbarte Einlage herabmindert oder eine bereits bestehende Belastung vertieft. Solche Zahlungen könnten zwar zu einer Haftung nach § 172 Abs. 4, § 171 Abs. 1 HGB führen. Diese Vorschriften beträfen aber ausschließlich die Haftung des Kommanditisten gegenüber den Gesellschaftsgläubigern im Außenverhältnis und nicht dessen Verhältnis zur Gesellschaft. Ein Rückgewähranspruch der Gesellschaft entstehe bei einer Rückzahlung der Einlage somit nicht automatisch, sondern könne sich nur aus anderen Rechtsgründen ergeben, insbesondere aus einer entsprechenden vertraglichen Abrede.
Der Gesellschaftsvertrag enthält jedoch aus Sicht des BGH nach objektiver Auslegung keine klare und unmissverständliche Regelung darüber, dass Liquiditätsüberschüsse, die auf der Grundlage von Gesellschaftsbeschlüssen ausgeschüttet werden, den Kommanditisten lediglich als Darlehen zur Verfügung gestellt werden. Der zweite Halbsatz der oben genannten Regelung im Gesellschaftsvertrag könne von den Gesellschaftern auch dahin verstanden werden, dass Ausschüttungen, die die Gesellschafterversammlung beschlossen hat, als entsprechende Forderungen der Kommanditisten gegen die Gesellschaft auf ihrem Gesellschafterkonto zu verbuchen sind. Insoweit seien die auf der Grundlage eines Gesellschafterbeschlusses ausgeschütteten Liquiditätsüberschüsse im Sinne der genannten Regelung des Gesellschaftsvertrages durch ein entsprechendes „Guthaben auf den Gesellschafterkonten gedeckt“. Darüber hinaus enthalte der Gesellschaftsvertrag keine Regelung der Voraussetzungen, unter denen die gegebenenfalls als Darlehen gewährten Ausschüttungen zurückzuzahlen sind. Das Fehlen von Rückzahlungsvoraussetzungen festige die bestehende Unklarheit über die Einstufung der Ausschüttungen als Darlehen.
Zuständigkeit des Beirats für Vertretung der GmbH im Prozess gegen Geschäftsführer
BGH, Beschluss vom 2. Februar 2016 – II ZB 2/15
Der Kläger, ehemaliger Geschäftsführer der beklagten GmbH, wendet sich gegen die fristlose Kündigung seines Anstellungsverhältnisses. Er verlangt im Wege des Urkundsprozesses Zahlung der entsprechenden Geschäftsführervergütung. Nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages der Beklagten waren dem dreiköpfigen Beirat die nach der gesetzlichen Vorschrift des § 46 GmbHG zum Aufgabenkreis der Gesellschafter gehörenden Kompetenzen übertragen worden. Der Kläger erhob die Klage gegen die Beklagte, vertreten durch den Beirat, der wiederum einen Prozessbevollmächtigten beauftragte. In der mündlichen Verhandlung erkannte die Beklagte im Urkundsprozess die Vergütungsansprüche an und wurde entsprechend zur Zahlung der Geschäftsführervergütung verurteilt. Die Beklagte hat, vertreten durch ihren (neuen) Geschäftsführer, gegen das Anerkenntnisvorbehaltsurteil Berufung eingelegt. Sie vertrat die Ansicht, die gegen die Beklagte, vertreten durch den Beirat, gerichtete Klage sei gegen eine nicht ordnungsgemäß vertretene Partei erhoben worden. Zuständiges Vertretungsorgan der Beklagten für den Sachverhalt sei gemäß § 35 Abs. 1 S. 1 GmbHG die Geschäftsführung. Die Berufung wurde zurückgewiesen, da die beklagte GmbH im Rahmen der Einlegung der Berufung durch den allein durch ihren Geschäftsführer beauftragten Prozessbevollmächtigten nicht ordnungsgemäß vertreten gewesen sei.
Dieser Sichtweise gab der BGH nun in vorliegender Entscheidung Recht: Prozessvertreter der Beklagten gemäß § 46 Nr. 8 Alt. 2 GmbHG im vorliegenden Rechtsstreit mit dem früheren Geschäftsführer sei der Beirat der Beklagten. Es entspreche der ständigen Rechtsprechung des BGH, dass es nach § 46 Nr. 8 Alt. 2 GmbHG der Gesellschafterversammlung (hier also dem Beirat, dem diese Kompetenz übertragen war) obliegt, einen Vertreter der Gesellschaft in Prozessen zu bestimmen, die die Gesellschaft gegen einen Geschäftsführer führt. Diese Vorschrift, die sowohl für Aktiv- wie auch für (hier) Passivprozesse gelte, solle die unvoreingenommene Prozessführung in Rechtsstreitigkeiten sicherstellen, in denen regelmäßig die Gefahr bestehe, dass die nach § 35 GmbHG an sich zur Vertretung der Gesellschaft berufenen Geschäftsführer befangen sind. Sie umfasse auch Prozesse gegen ausgeschiedene Geschäftsführer. Gleichwohl könne die Gesellschaft durch einen neuen Geschäftsführer so lange vertreten werden, wie die Gesellschafterversammlung (hier: der Beirat) nicht von ihrer Befugnis Gebrauch macht, einen anderen besonderen Vertreter zu bestellen. Im vorliegenden Fall habe der Beirat seinen Willen im Hinblick auf eine Beschlussfassung gemäß § 46 Nr. 8 Alt. 2 GmbHG ausreichend klar zum Ausdruck gebracht.
Verhandlungsbereitschaft schließt AGB-Kontrolle nicht aus
BGH, Urteil vom 20. Januar 2016 – VIII ZR 26/15
Der BGH befasste sich in dieser Entscheidung unter anderem mit einer Voraussetzung für das Vorliegen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, dem Merkmal des „Stellens von Geschäftsbedingungen“.
Der Kläger, ein Pharmahersteller, belieferte den Beklagten, einen Arzneimittelgroßhändler, mit Arzneimitteln, die ausschließlich zur Verwendung von Hilfslieferungen bestimmt waren. Der Kläger machte im Rahmen dieses Verfahrens gegen den Beklagten eine Vertragsstrafe in Höhe von EUR 250.000 geltend, weil dieser die Arzneimittel kommerziell weiter veräußert hatte. Vor Vertragsabschluss wurde dem Beklagten der Vertragstext mit folgender Anmerkung zugeschickt: „Falls Sie Anmerkungen oder Änderungswünsche haben, lassen Sie uns dies bitte wissen.“ Der Vertrag wurde anschließend unverändert geschlossen, wobei unstreitig ist, dass ein Aushandeln der Vertragsstrafenklausel zwischen den Parteien im Einzelnen nicht stattfand. Das OLG Köln, als Vorinstanz, verneinte das Vorliegen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, weil der Kläger die Bedingungen nicht „gestellt“ habe und daher nicht Verwender derselben gewesen sei.
Diese Ansicht lehnte der BGH ab. Er urteilte, dass dem Kläger kein Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe zusteht. Es handele sich bei der entsprechenden Vertragsbestimmung um eine Allgemeine Geschäftsbedingung, die der Inhaltskontrolle nicht standhält und deshalb insgesamt unwirksam ist. Der Kläger sei Verwender der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das OLG Köln habe nach Ansicht des BGH die voneinander zu trennenden Fragen des Stellens und des Aushandelns von Allgemeinen Geschäftsbedingungen miteinander vermengt. Verwender sei nach der Legaldefinition in § 305 Abs. 1 S. 1 BGB diejenige Vertragspartei, die der anderen Partei bei Abschluss eines Vertrages vorformulierte Vertragsbedingungen „stellt“. Demgegenüber regele § 305 Abs. 1 S. 3 BGB, dass Allgemeine Geschäftsbedingungen nicht vorliegen, soweit die Vertragsbedingungen im Einzelnen ausgehandelt worden sind, selbst wenn sie im Übrigen die Merkmale des § 305 Abs. 1 BGB aufwiesen. Nach Auffassung des BGH sind vorformulierte Vertragsbedingungen dann nicht „gestellt“, wenn sie aufgrund einer freien Entscheidung desjenigen in den Vertrag einbezogen werden, der vom anderen Vertragsteil mit dem Verwendungsvorschlag konfrontiert wurde. Dazu sei notwendig, dass er in der Auswahl der in Betracht kommenden Vertragstexte frei war und insbesondere Gelegenheit erhielt, alternativ eigene Textvorschläge mit der effektiven Möglichkeit ihrer Durchsetzung in die Verhandlungen einzubringen.
Das Schweigen der Beklagten auf die im Anschreiben geäußerte Bitte, „Anmerkungen oder Änderungswünsche“ mitzuteilen, lasse die Verwendereigenschaft des Klägers demzufolge nicht entfallen. Mit der Bitte, „Anmerkungen oder Änderungswünsche“ mitzuteilen, habe der Kläger sich zwar offen dafür gezeigt, entsprechende Erklärungen entgegenzunehmen und damit eine gewisse Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Dem Beklagten sei durch die bloße Frage nach „Anmerkungen oder Änderungswünschen“ jedoch aus Sicht des BGH keine tatsächliche Gelegenheit eröffnet worden, alternativ eigene Textvorschläge mit der effektiven Möglichkeit ihrer Durchsetzung in die Verhandlung einzubringen. Anders als in der Literatur teilweise vertreten, lässt auch das Schweigen auf eine solche Bitte die Verwendereigenschaft nicht entfallen. An der Eigenschaft des Klägers als Klauselverwender ändere es daher nichts, dass der Kläger möglicherweise uneingeschränkt bereit gewesen sei, auf Änderungswünsche der Beklagten einzugehen, und der Beklagte von einer etwaigen Verhandlungs- und Gestaltungsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.
Darüber hinaus hat der BGH seine Rechtsprechung bestätigt, nach der eine Vertragsstrafenklausel wegen unangemessener Benachteiligung im Sinne des § 307 Abs. 1 S. 1 BGB unwirksam ist, wenn sie für Vertragsverletzungen von erheblich unterschiedlichem Gewicht ein und denselben Betrag vorsieht. Eine solche Regelung sei nur wirksam, wenn sie auch angesichts des typischerweise geringsten Vertragsverstoßes noch angemessen ist. Hiervon war im vorliegenden Fall nicht auszugehen.
Auflösung einer stillen Gesellschaft als bloße Innengesellschaft führt zu sofortiger Beendigung
BGH, Urteil vom 8. Dezember 2015 – II ZR 333/14
Der BGH befasste sich in vorliegendem Verfahren mit der Rechtsfrage, ob nach dem Liquidationsbeschluss der atypisch still an einer GmbH & Co. KG beteiligten Gesellschafter die stille Gesellschaft als sofort aufgelöst gilt und die Anleger ihr sogenanntes Auseinandersetzungsguthaben verlangen können, ohne dass bereits sämtliche Schulden des Geschäftsherrn getilgt sind.
Der Kläger hatte sich als atypisch stiller Gesellschafter an einer Aktiengesellschaft beteiligt, deren Rechtsnachfolger die Beklagte, eine GmbH & Co. KG, ist. Nachdem die Beklagte in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, beschlossen die stillen Gesellschafter, die stille Gesellschaft zu liquidieren. Ein Beschluss über die Liquidation der Beklagten kam jedoch nicht zustande. Der Kläger begehrte die Verurteilung der Beklagten zur Errechnung und Auszahlung seines Auseinandersetzungsguthabens.
Der BGH gab dem Kläger Recht. Er entschied, dass die stille Gesellschaft durch den Beschluss der stillen Gesellschafter beendet worden sei und den Gesellschaftern bei Beendigung der stillen Gesellschaft nach den Regelungen des atypisch stillen Gesellschaftsvertrages ein Abfindungsguthaben zustehe. Dieser Anspruch entstehe auch nicht erst, nachdem sämtliche Schulden der Beklagten berichtigt worden seien. Der Beschluss über die Auflösung einer BGB-Innengesellschaft, zu der auch die stille Gesellschaft gehöre, führe grundsätzlich zur sofortigen vollen Beendigung derselben. Da bei einer bloßen Innengesellschaft kein gesamthänderisch gebundenes Gesellschaftsvermögen vorhanden sei, komme eine Liquidation wie bei einer (teil)rechtsfähigen Personen(handels)gesellschaft nicht in Betracht. Insbesondere habe die stille Gesellschaft keine Verbindlichkeiten, die im Rahmen einer Liquidationsphase vorrangig zu erfüllen sein könnten.
Für eine mehrgliedrige stille Gesellschaft gelten aus Sicht des BGH jedenfalls dann keine Besonderheiten, wenn ihre Auflösung nicht mit einer Liquidation des Geschäftsherrn einhergeht. Der Umstand, dass eine Vielzahl von stillen Gesellschaftern mit dem Geschäftsherrn in einem Gesellschaftsverhältnis miteinander verbunden ist und sich hieraus Treuepflichten untereinander ergeben, die u.a. dazu führen, dass die gesellschaftsrechtlichen Abfindungs- und Auseinandersetzungsansprüche der einzelnen Beigetretenen nur im Wege einer geordneten Auseinandersetzung geltend gemacht werden können, ändere nichts daran, dass auch die mehrgliedrige stille Gesellschaft keine zu tilgenden Verbindlichkeiten hat. Schuldner der Abfindungs- und Auseinandersetzungsansprüche bleibe auch im Falle der mehrgliedrigen stillen Gesellschaft der Geschäftsherr. Es ergebe sich auch aus der Verbundenheit der stillen Gesellschafter untereinander und zum Geschäftsherrn keine Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Gläubiger des Geschäftsherrn.
Daran ändere sich auch dadurch nichts, dass die mehrgliedrige stille Gesellschaft hier als „Innen-KG“ ausgestaltet wurde. Die mehrgliedrige stille Gesellschaft habe als solche auch in der Ausgestaltung als sogenannte „Innen-KG“ keine eigenen Verbindlichkeiten, die in entsprechender Anwendung der § 149, § 155, § 161 Abs. 2 HGB vorweg befriedigt werden könnten. Die Auflösung der stillen Gesellschaft führe, auch wenn sie als sogenannte „Innen-KG“ ausgestaltet sei, nicht bereits als solche zur Liquidation des Geschäftsherrn. Innen- und Außenverhältnis würden auch nach dem Auflösungsbeschluss der stillen Gesellschaft rechtlich getrennt bleiben. Rechtsträger des Unternehmens sei nach wie vor der Geschäftsherr. Die Liquidation des Geschäftsherrn richte sich grundsätzlich nach den für diesen geltenden Rechtsvorschriften und erfordere, wenn es sich bei dem Geschäftsherrn wie hier um eine Gesellschaft handelt, einen Auflösungsbeschluss der Gesellschafter des Geschäftsherrn.
Unter Fortführung des Unternehmens des Geschäftsherrn würde die gegenteilige Ansicht zudem zur Folge haben, dass eine Abwicklung der offenen Positionen nie zu einem Ende käme. Bei laufendem Geschäftsbetrieb würden fortwährend neue Forderungen entstehen und Verbindlichkeiten begründet. Eine Mitteilung des Endstandes an Verbindlichkeiten, deren Tilgung vorrangig sein könnte, wäre erst dann möglich, wenn der Inhaber des Handelsgeschäfts seinen Geschäftsbetrieb einstellt.
Bindung an eine Schiedsvereinbarung bei rein tatsächlicher Fortführung eines Handelsgeschäfts
KG Berlin, Beschluss vom 13. August 2015 – 20 Sch 9/14
Das KG hatte in dieser Entscheidung die Rechtsfrage zu entscheiden, ob § 25 HGB im Fall einer rein tatsächlichen Fortführung eines Handelsgeschäfts zu einer Bindung des Erwerbers an eine Schiedsvereinbarung zwischen dem bisherigen Geschäftsinhaber und einem Dritten führt.
Zwischen der Schiedsklägerin und der Schiedsbeklagten und späteren Antragsgegnerin bestand ein Generalunternehmervertrag sowie ein Schiedsvertrag. Während eines laufenden Schiedsverfahrens, in dem sich die Schiedsklägerin und die Schiedsbeklagte gegenseitig auf Zahlung in Anspruch nahmen, stellte die Schiedsklägerin einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Schiedsklägerin wurde mangels Masse abgewiesen; sie wurde inzwischen aus dem Handelsregister gelöscht. Die Schiedsbeklagte nahm nunmehr eine Dritte GmbH, die Antragstellerin, wegen Firmenfortführung nach § 25 HGB im Wege der Drittwiderklage auf Zahlung in Anspruch. Diese widersprach ihrer Einbeziehung in das Schiedsverfahren.
Das KG bejahte eine Firmenfortführung durch die Antragstellerin sowie ‑ daraus folgend ‑ eine Bindung an die Schiedsvereinbarung zwischen der zwischenzeitlich aufgelösten Schiedsklägerin und der Schiedsbeklagten und nun Antragsgegnerin. Die Voraussetzungen des § 25 HGB seien gegeben. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH genüge für die Rechtsnachfolge im Sinne des § 25 HGB eine rein tatsächliche Fortführung des Handelsgeschäfts. Ein derivativer Erwerb sei keine zwingende Voraussetzung. § 25 HGB bezwecke den Schutz des Verkehrs, welcher keinen Einblick in die tatsächlichen Vertragsverhältnisse zwischen den Unternehmensträgern habe, so dass es hierauf auch nicht entscheidend ankommen könne. Der Wortlaut des § 25 HGB stehe dieser Sichtweise nicht entgegen. Soweit dort von einem „erworbenen Handelsgeschäft“ die Rede ist, sei dieser Begriff in einem untechnischen Sinne zu verstehen, da es aufgrund des sachenrechtlichen Spezialitätsprinzips gar nicht möglich sei, ein Unternehmen als solches zu „erwerben“. Tragender Grund für die Erstreckung der Haftung für früher im Betrieb des Unternehmens begründete Verbindlichkeiten des Vorgängers auf seinen Nachfolger sei die Firmenfortführung, weil hierdurch die Kontinuität des Unternehmens nach außen in Erscheinung tritt. Dies sei bei der Schiedsklägerin und der Antragstellerin erfüllt, da sich unter anderem die Büros an der gleichen Adresse befanden und beide sich ein Sekretariat teilten.
Das KG begründete eine Bindung der Antragstellerin als Rechtsnachfolgerin der Schiedsklägerin an die Schiedsvereinbarung mit dem durch § 25 HGB angeordneten Eintritt in die volle Rechtsstellung und einem Vergleich mit der Abtretung. Schiedsvereinbarungen seien im Zusammenhang mit der Haftung für Altverbindlichkeiten nach § 25 Abs. 1 S. 1 HGB als Nebenabreden zum Hauptanspruch anzusehen. Dies ergebe sich aus einem Vergleich mit der Abtretung, bei der nach ständiger Rechtsprechung des BGH eine Schiedsklausel entsprechend § 401 BGB mit dem abgetretenen Recht auf den Erwerber übergeht. Anderenfalls könnten sich Unternehmen durch einen Unternehmensübergang nach § 25 HGB von der schiedsvertraglichen Bindung von Altverbindlichkeiten befreien, wofür kein berechtigtes Interesse erkennbar sei.
Nennung der von GmbH zu tragenden Gründungskosten in Satzung
OLG Celle, Beschluss vom 11. Februar 2016 – 9 W 10/16
Die Beschwerdeführerin in diesem Registerverfahren begehrte ihre Eintragung als GmbH in das Handelsregister. Die Eintragung war der GmbH aufgrund einer Zwischenverfügung verwehrt worden, da das Registergericht die vorgelegte Satzungsregelung zur Übernahme der Gründungskosten durch die Gesellschaft für nicht ausreichend hielt und eine „namentliche“ Nennung der Gründungskosten, die die Gesellschaft tragen soll, forderte.
Dieser Sichtweise gab das OLG Celle Recht: Solle bei der Gründung einer GmbH in deren Satzung der Gründungsaufwand auf die Gesellschaft übertragen werden, so reicht aus Sicht des OLG Celle dafür die Formulierung: „Die Kosten der Gründung der Gesellschaft bis zu einem Betrag von EUR 3.000 trägt die Gesellschaft“ nicht aus. Vielmehr sei es aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, wenn das Registergericht die namentliche Nennung derjenigen Gründungskosten verlangt, die die Gesellschaft tragen soll. Für eine weniger strenge Handhabung, die eine Formulierung wie im Streitfall für ausreichend erachtet, spreche zwar, dass die Gründung einer Unternehmergesellschaft mittels Musterprotokolls die Übernahme namentlich nicht, nicht einmal der Art nach, genannter Gründungskosten gestattet. Für die Bestätigung der strengen Sicht des Registergerichts im Streitfall gebe letztlich jedoch den Ausschlag, dass die Anforderungen an eine GmbH strenger sein sollten als an eine Unternehmergesellschaft, auf deren Bestands- und Wirtschaftskraft der Rechtsverkehr, insbesondere ihre Gläubiger, mangels nennenswerten Stammkapitals ohnehin kein Vertrauen setzen können. Hinzu komme, dass sich für die konkrete Nennung der einzelnen auf die jeweilige Gesellschaft abgewälzten Gründungskosten als erlaubte Vorbelastung anführen lässt, dass der Verzicht auf ihre Nennung Missbräuchen Tür und Tor öffnet. Einen solchen Missbrauch sähe das OLG Celle beispielsweise darin, dass aus dem Haftkapital, mit dessen Bereitstellung gerade die Möglichkeit der Teilnahme am Rechtsverkehr unter Beschränkung der Haftung erkauft wird, ein „Gründerlohn für die Gesellschafter“ auf die Gesellschaft übergewälzt werden könne.
Vertretung einer GmbH & Co. KG in Liquidation
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 28. Januar 2016 – I-3 Wx 21/15
Die Beteiligte zu 1. ist eine GmbH & Co. KG, die nach dem Beschluss über ihre Beendigung und der Verteilung der Vermögenswerte, aus dem Handelsregister gelöscht wurde, obwohl sie zu dieser Zeit noch Grundbesitz hatte. Die Beteiligte zu 2 war Kommanditistin, die Beteiligte zu 3 die alleinvertretungsberechtigte Komplementär GmbH der Beteiligten zu 1. Mehrere Versuche der Komplementär GmbH, den verbleibenden Grundbesitz der Gesellschaft auf die Kommanditistin zu übertragen, wurden durch das Grundbuchamt zuletzt mit Zwischenverfügung zurückgewiesen, da die Vertretungsberechtigung der Komplementär GmbH nicht in der grundbuchrechtlich vorgeschriebenen Form nachgewiesen wurde. Der Notar wendete sich hiergegen und begehrte die Aufhebung der Zwischenverfügung sowie Eintragung im Grundbuch.
Das OLG Düsseldorf wies die Beschwerde zurück. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf ist die Vertretungsberechtigung der Beteiligten zu 3. weder, wie nach § 29 Abs. 1 S. 2 GBO erforderlich, offenkundig noch durch öffentliche Urkunden nachgewiesen worden. Zwar sei dem Handelsregister zu entnehmen, dass die GmbH & Co. KG ursprünglich durch die Komplementär GmbH als ihre Komplementärin vertreten wurde. Diese Vertretungsbefugnis sei indessen entfallen, als die Gesellschafter die Beendigung der Gesellschaft und die Verteilung ihrer Vermögenswerte beschlossen. Dieser Beschluss habe nach § 131 Abs. 1 Nr. 2 HGB zur Auflösung der Gesellschaft geführt, womit Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungsberechtigung , wie sie nach Gesetz und Vertrag für die werbende Gesellschaft galten, erloschen. Für die sich gemäß § 145 HGB an die Auflösung der Gesellschaft anschließende Phase der Liquidation sei eine alleinige Vertretungsbefugnis der Komplementär GmbH für die GmbH & Co. KG nicht in der grundbuchrechtlich vorgesehenen Form nachgewiesen. Während der Liquidation werde die Gesellschaft gemäß § 149 S. 2 HGB durch ihre Liquidatoren gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Das habe jedoch eine alleinige Vertretungsbefugnis der Komplementär GmbH für die GmbH & Co. KG nur dann zur Folge, wenn sie durch Beschluss der Gesellschafter zur alleinigen Liquidatorin bestellt worden sei, da ansonsten die Liquidation gemäß § 146 HGB nur durch sämtliche Gesellschafter einschließlich der Kommanditisten gemeinschaftlich erfolge. Das OLG Düsseldorf ließ es dahinstehen, ob in dem die Liquidation beschließenden Gesellschafterbeschluss eine konkludente Bestellung der Komplementär GmbH zur Liquidatorin gesehen werden könne, da dieser Beschluss jedenfalls nicht in der durch § 29 GBO vorgeschriebenen Form vorgelegt worden sei.
Schadensersatzklage gegen frühere Vorstandsmitglieder wegen Zinsswap-Geschäften
OLG Düsseldorf, Urteil vom 15. Januar 2016 – I-6 U 48/14
Der Kläger ist Insolvenzverwalter einer Aktiengesellschaft und verlangt von früheren Vorstandsmitgliedern Schadensersatz wegen pflichtwidrig abgeschlossener Zinsswap-Geschäfte. Die beklagten Vorstandsmitglieder schlossen mit einer Bank einen Darlehensvertrag über eine Zwischenfinanzierungslinie für Immobilienkäufe ab. Mit dem Darlehensvertrag wurde die Gesellschaft zur Zinssicherung verpflichtet, Forward-Zinsswapgeschäfte mit mehrjähriger Laufzeit abzuschließen. Die Finanzierungskreditlinie wurde nicht vollständig ausgeschöpft, so dass im Ergebnis die Zinsswapgeschäfte nicht in Umfang und Dauer mit entsprechenden Darlehensverträgen unterlegt waren. Der Kläger macht geltend, dass die Beklagten durch den Abschluss des Darlehensvertrages mit der Bank eine Pflichtverletzung begangen haben, da der Darlehensvertrag eine Verpflichtung der Schuldnerin zum Abschluss von Zinsswapverträgen begründet haben, obwohl zum Zeitpunkt des Abschlusses des Darlehensvertrages das Zustandekommen einer Anschlussfinanzierung durch den Abschluss von den Zinsswaps nach Umfang und Zeitdauer entsprechenden Darlehensverträgen nicht sichergestellt war. Das LG Düsseldorf hatte die Klage in der Vorinstanz abgewiesen. Hiergegen richtete sich die hier zu entscheidende Berufung des Klägers.
Das OLG Düsseldorf gab dem Kläger Recht und verurteilte die Beklagten als Gesamtschuldner zu Schadensersatz wegen Pflichtverletzung aus § 93 Abs. 1 S. 1 AktG, § 249, § 421 BGB. Das OLG Düsseldorf verneinte zunächst eine Pflichtwidrigkeit in Form der Missachtung eines Zustimmungsvorbehalts. Der Zustimmungsvorbehalt, dessen Geltung zwischen den Parteien im Übrigen streitig ist, mit dem Wortlaut „Finanzierungen, soweit diese nicht den normalen Geschäftsverkehr betreffen und sie in der Bedeutung für das Unternehmen als wesentlich zu betrachten sind“ sei aufgrund seiner fehlenden Bestimmtheit unwirksam. § 111 Abs. 4 S. 2 AktG enthalte zwar keine inhaltlichen Vorgaben für die Formulierung von Zustimmungsvorbehalten. Die Vorschrift verlange aber schon seinem Wortlaut nach die eindeutige Bezeichnung der zustimmungsbedürftigen Maßnahme oder Entscheidung, da sich der Zustimmungsvorbehalt auf „bestimmte Arten von Geschäften“ beziehen muss. Damit stehe zugleich fest, dass einerseits eine inhaltsleere Generalklausel, die beispielsweise lediglich den Gesetzeswortlaut oder die Formulierung unter Ziffer 3.3 DCGK wiedergibt, nicht ausreichend sein kann, aber andererseits auch ein bis ins Detail gehender Katalog von Vorbehaltstatbeständen nicht zu fordern ist. Die Pflicht des Aufsichtsrats nach § 111 Abs. 4 S. 2 AktG ziele unter Berücksichtigung des Wortlauts der Vorschrift und ihres Zwecks, die präventive Einbindung des Aufsichtsrats bei wesentlichen Maßnahmen des Vorstands und der Verbesserung der Corporate Governance, auf die Schaffung eines auf die Verhältnisse der konkreten Gesellschaft zugeschnittenen Mindestkatalogs zustimmungsbedürftiger Geschäfte von grundlegender Bedeutung. Was unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse der betroffenen Gesellschaft als „grundlegendes Geschäft“ in diesem Sinne anzusehen sei, habe der Aufsichtsrat „unternehmensbezogen zu konkretisieren“. Darin, wie er diese Konkretisierung vornimmt, sei der Aufsichtsrat zwar weitgehend frei. Er könne hierbei insbesondere die erfassten Geschäfte nach allgemeinen Merkmalen, d.h. zum Beispiel nach Geschäftstypen, bestimmen und dabei auch konkrete Schwellenwerte oder Betragsgrenzen vorsehen. Entscheidend sei jedoch, dass die zustimmungsbedürftige Maßnahme für den Vorstand eindeutig erkennbar ist. Gemessen an diesen Anforderungen sei die hier gewählte Formulierung deshalb nicht ausreichend, weil sie zwar einen konkreten Geschäftstyp bezeichnet, nämlich die „Finanzierung“, sodann aber lediglich in generalklauselartiger Weise zu umschreiben versuche, welche „Finanzierungen“ zustimmungsbedürftig sein sollen. Konkrete Kriterien oder Anhaltspunkte, anhand derer die Beklagten als Vorstandsmitglieder hätten erkennen können, ob eine anstehende Finanzierungsmaßnahme zustimmungsbedürftig ist oder nicht, fehlen nach Ansicht des OLG Düsseldorf. Die gewählten Begriffe „normaler Geschäftsverkehr“ und „wesentlich“ seien ihrerseits auslegungsbedürftig, wobei jedoch der vom Aufsichtsrat formulierte Katalog für die erforderliche Auslegung keine Hilfestellung in Form von den Verhältnissen der Gesellschaft angepassten Grenzwerten oder ähnlichem biete.
Die Pflichtverletzung der Beklagten folge auch nicht aus dem bloßen Abschluss der Zinsswap-Geschäfte, da es kein generelles Verbot zum Abschluss spekulativer Geschäfte gäbe, sofern der Unternehmensgegenstand nicht gesetzlich eingeschränkt sei. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf waren die Zinsswap-Geschäfte nicht grundsätzlich verboten, sondern ‑ sofern es sich nicht von vornherein um reine Spekulationsgeschäfte gehandelt habe ‑ als Hilfsgeschäfte im Rahmen der Finanzierung von Immobilien erlaubt.
Das OLG Düsseldorf bejahte aber ein mögliches pflichtwidriges Verhalten der Beklagten dadurch, dass sie die Aktiengesellschaft durch Abschluss des Darlehensvertrages dazu verpflichteten, mehrjährige Zinsswaps in erheblichem Umfang abzuschließen, obwohl das Zustandekommen der Anschlussfinanzierung in dieser Höhe nicht sichergestellt war, sondern vielmehr das Risiko bestand, dass ein kongruentes Grundgeschäft nicht zustande kommen würde und die Zinsswapgeschäfte deswegen nur teilweise Zinssicherungscharakter haben würden. Es wäre angesichts dieser möglichen Pflichtverletzung Sache der Beklagten gewesen, diese zu widerlegen. Die Beklagten konnten jedoch diesen gemäß § 93 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 2 AktG erforderlichen Entlastungsbeweis nicht erbringen. Die Beklagten haben aus Sicht des OLG Düsseldorf nicht darlegen können, dass sie davon ausgehen durften, die Gesellschaft könne kongruente Darlehensverträge zu den abgeschlossenen Zinssicherungsgeschäften abschließen. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf sei anhand des Vortrags der Beklagten nicht festzustellen gewesen, dass diese vernünftigerweise annehmen durften, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Gesellschaft zu handeln.
Der BGH hat zwischenzeitlich die Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen.
Angemessenheit der Gegenleistung im Rahmen von Übernahmeangebot
OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 19. Januar 2016 – 5 U 2/15 („Magnetar/McKesson“)
Die Parteien streiten um die Angemessenheit der Gegenleistung im Rahmen eines Aktien-Übernahmeangebots gemäß § 31 Abs. 1, Abs. 6 S. 1 WpÜG. Die Kläger waren Aktionäre einer Aktiengesellschaft, deren Übernahme die Beklagte plante. Hierzu kaufte die Beklagte Wandelanleihen, die ihr ein Recht zur Wandlung in Aktien gewährten, zu einem Preis von ca. EUR 31 pro Aktie sowie Aktien vom Großaktionär der Aktiengesellschaft zu einem Preis von EUR 23,50 pro Aktie. Nach Übertragung der Wandelanleihen übte die Beklagte ihre Wandlungsrechte aus. Später gab die Beklagte ein auf den Erwerb sämtlicher Aktien gerichtetes öffentliches Übernahmeangebot zum Preis von EUR 23,50 pro Aktie ab. Auf das Angebot lieferten die Kläger ihre Aktien ein. Die Kläger sind der Ansicht, dass der angebotene Preis von EUR 23,50 keine angemessene Gegenleistung sei, da mindestens der für die Wandelanleihen gezahlte Preis von ca. EUR 31 gezahlt werden müsse. Sie forderten von der Beklagten den Differenzbetrag pro eingereichter Aktie.
Das OLG gab den Klägern Recht und entschied, dass den Klägern die geltend gemachten Erhöhungsansprüche gemäß § 31 Abs. 1, Abs. 6 S. 1 WpÜG in Verbindung mit § 4 WpÜG-AngVO zustehen. Nach Auffassung des OLG war die angebotene und gezahlte Abfindung vorliegend nicht angemessen. Maßgeblich für die Höhe der Abfindung sei der höchste für den Erwerb der Wandelanleihen (bezogen auf eine Aktie) gezahlte Betrag, da diese von der Beklagten innerhalb der Frist von § 31 Abs. 3 WpÜG erworben und gewandelt worden seien. Zwar sei mit dem Begriff „Erwerb“ in § 4 S. 1 WpÜG-AngVO der dingliche Erwerb von Aktien gemeint. Jedoch verweise § 4 S. 2 WpÜG-AngVO auf § 31 Abs. 6 S. 1 WpÜG, der dem Erwerb von Aktien Vereinbarungen gleich stellt, auf Grund derer die Übereignung von Aktien verlangt werden kann. Jedenfalls im vorliegenden Fall, in dem die von der Beklagten als Bieterin erworbenen Wandelanleihen innerhalb der maßgeblichen Frist gemäß § 31 Abs. 3 WpÜG erworben und in Aktien gewandelt wurden, sei eine Gleichstellung mit einem Aktienerwerb gemäß § 31 Abs. 6 S. 1 WpÜG geboten.
Hierfür spreche der Sinn und Zweck der Regelung des § 31 Abs. 6 S. 1 WpÜG. Zweck des WpÜG sei es, den Beteiligten eine schnelle und möglichst rechtssichere Abwicklung öffentlicher Markttransaktionen zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund, der auch das Interesse des Bieters an der Vorhersehbarkeit seiner Belastung schützt, bestimme § 31 WpÜG, dass der Bieter den Aktionären der Zielgesellschaft eine angemessene Gegenleistung für ihre Aktien anzubieten habe und diene damit deren Interesse. Ergänzend zu den Vorschriften der Abs. 1 bis 5 soll Abs. 6 einer Umgehung der auf den dinglichen Erwerb bezogenen Regeln durch schuldrechtliche Vereinbarungen über ein Erwerbsrecht vorbeugen. Für das Ergebnis müssten somit das Interesse des Bieters an der Rechtssicherheit und das Interesse der Aktionäre an der Angemessenheit der Gegenleistung abgewogen werden. Im vorliegenden Fall hätten die von der Beklagten erworbenen Wandelschuldverschreibungen sowohl inhaltlich (nämlich hinsichtlich ihrer Eignung zur Erreichung des Ziels einer 75%igen Mehrheitsbeteiligung an der AG) als auch zeitlich (nämlich innerhalb der Frist des § 31 Abs. 3 WpÜG) den von der Beklagten erworbenen Aktien gleichgestanden. Aus dem Umstand, dass die Beklagte die Anleihen einen bzw. wenige Tage nach ihrem Erwerb wandelte, folge zwanglos, dass sie diese nicht wegen der bestehenden Verzinsung erwarb, sondern wegen ihrer aktiengleichen Funktion im Zusammenhang mit der erstrebten Übernahme der Aktiengesellschaft. Nach Auffassung des OLG Frankfurt am Main spreche dies dafür, den vorliegenden Fall der Regelung des § 31 Abs. 6 S. 1 WpÜG zu unterstellen.
Das OLG Frankfurt am Main stellte jedoch klar, dass es grundsätzlich problematisch ist, die Anwendung von § 31 Abs. 6 S. 1 WpÜG davon abhängig zu machen, ob der Bieter schon bei Erwerb der Anleihen beabsichtigt, das Wandlungsrecht auszuüben, oder dass dessen Ausübung Voraussetzung dafür ist, dass der Bieter sein mit dem Übernahmeangebot verfolgtes Ziel erreicht. Denn die Ermittlung der Motive könne im Einzelfall schwierig sein und daher eine Unsicherheit erzeugen. Objektiv feststellbar ‑ und unstreitig ‑ sei jedoch, dass die Beklagte innerhalb der Frist des § 31 Abs. 3 WpÜG (sechs Monate vor der Veröffentlichung des Angebots bis zum Ablauf der Annahmefrist) die Anleihen sowohl erworben als auch tatsächlich gewandelt hat. Damit sei der Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot objektiv gegeben. Die erworbenen Anleihen stünden im Ergebnis den innerhalb der maßgeblichen Frist erworbenen Aktien gleich. Die Verzinsungskomponente trete gegenüber der „Aktienkomponente“ (objektiv) zurück.
Das OLG hat die Revision zum BGH wegen grundsätzlicher Bedeutung der Anwendbarkeit des § 31 Abs. 6 S. 1 WpÜG zugelassen.
Kompetenzverteilung in einer GmbH & Co. KG, Rechtsschutzbedürfnis & Einberufungsfrist
OLG Hamm, Urteil vom 28. Oktober 2015 ‑ 8 U 73/15
Die Parteien des Verfahrens streiten über die Kompetenzverteilung in einer personen- und beteiligungsgleichen GmbH & Co. KG sowie um den Beginn der Einberufungsfrist nach § 51 Abs. 1 GmbHG.
Der Kläger und ein weiterer Gesellschafter sind je zu 50% als Kommanditist an einer GmbH & Co. KG sowie als geschäftsführender Gesellschafter der Komplementär-GmbH beteiligt. Der zweite Gesellschafter-Geschäftsführer lud den Kläger zu einer ersten Gesellschafterversammlung der Komplementär-GmbH ein. Nachdem der Kläger zu dieser Gesellschafterversammlung nicht erschienen war, lud der Geschäftsführer per Einschreiben zu einer weiteren Gesellschafterversammlung. Die Ehefrau des Klägers verweigerte die Annahme des Einschreibens, das anschließend durch einen Gerichtsvollzieher zugestellt wurde. Der Kläger erschien zu der Gesellschafterversammlung, rügte u.a. die aus seiner Sicht fehlerhafte Einberufung und verließ danach die Versammlung. Der zweite Gesellschafter-Geschäftsführer fasste daraufhin diverse Beschlüsse, gegen die sich der Kläger nun wendet. Er ist der Ansicht, die in der Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse seien anfechtbar bzw. nichtig, da die gesellschaftsvertragliche Einberufungsfrist nicht gewahrt worden sei. Zudem beträfen sie Angelegenheiten der GmbH & Co. KG, seien aber in einer Gesellschafterversammlung der Komplementär-GmbH gefasst worden.
Das LG Münster gab der Klage statt. Das OLG Hamm hielt nun die Berufung der beklagten Komplementär-GmbH nur für teilweise begründet. Es stellte zunächst klar, dass eine Anfechtungs- bzw. Nichtigkeitsklage gegen einen Beschluss der Gesellschafterversammlung einer GmbH grundsätzlich nicht von einem individuellen Rechtsschutzbedürfnis des klagenden Gesellschafters getragen sein müsse. Das Rechtsschutzbedürfnis fehle nur ausnahmsweise, wenn keinerlei objektives Bedürfnis für eine Nichtigerklärung des Beschlusses besteht, etwa weil der Beschlussinhalt gänzlich ins Leere geht oder – zum maßgeblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung – überholt ist. Dies war im vorliegenden Fall hinsichtlich einzelner Beschlüsse gegeben. Insoweit wurde die Berufung abgewiesen.
Das OLG Hamm hielt die Einberufungsfrist vorliegend für eingehalten. Für die Wahrung der Einberufungsfrist des § 51 Abs. 1 GmbHG komme es nicht auf den tatsächlichen Zugang des Einladungsschreibens, sondern auf den Zeitpunkt des regelmäßig zu erwartenden Zugangs an. Das gelte auch für eine in der Satzung anderweitig bemessene Einberufungsfrist. Nachdem die Einladung an einem Donnerstag zur Post gegeben wurde, sei spätestens bis Montag mit einem Zugang beim Kläger zu rechnen gewesen. Die Annahmeverweigerung der Ehefrau des Klägers sei im Übrigen als unberechtigte Annahmeverweigerung zu werten, die dem Zugang gleichzusetzen sei.
Der Beschluss der Gesellschafterversammlung der Komplementär-GmbH zur Qualifizierung der monatlichen Entnahmen der Geschäftsführer bei der GmbH & Co. KG als Tätigkeitsvergütung betraf jedoch nach Ansicht des OLG Hamm eine Angelegenheit der GmbH & Co. KG und wäre daher in den Zuständigkeitsbereich der Gesellschafterversammlung der KG gefallen. Diese Kompetenzüberschreitung hatte aus Sicht des OLG Hamm die Anfechtbarkeit dieses Beschlusses zur Folge. Grundsätzlich sei die innere Willensbildung einer Personengesellschaft zwar Sache der Gesellschafter als Herren der Gesellschaft. Hieraus folge aber nicht die umfassende und alleinige Beschlusskompetenz der Gesellschafterversammlung für sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft. So sei in der KG zu berücksichtigen, dass die Kommanditisten gemäß § 164 S. 1 HGB von der Geschäftsführung ausgeschlossen sind und die Komplementäre nicht den Weisungen der Kommanditisten unterliegen. Etwas anderes gelte gemäß § 164 S. 1 HGB nur für außergewöhnliche Geschäfte im Sinne von § 116 Abs. 2 HGB, die auch in der Kommanditgesellschaft der Zustimmung der Gesellschafter bedürfen. Hieraus folge, dass die Entscheidungskompetenz für Maßnahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes in der Kommanditgesellschaft beim Komplementär und nicht bei der Gesellschafterversammlung liegt. Ein Gesellschafterbeschluss der KG, der Maßnahmen der laufenden Geschäftsführung betrifft, greife deshalb rechtswidrig in die Befugnisse des Komplementärs als Geschäftsführungsorgan ein. Diese Grundsätze gelten aus Sicht des OLG Hamm auch für die Komplementär-GmbH in der GmbH & Co. KG. Der Umstand, dass es sich bei der Beklagten um eine sogenannte personen- und beteiligungsgleiche GmbH & Co. KG handelt, sei in diesem Zusammenhang unerheblich. Denn auch bei einer personen- und beteiligungsgleichen GmbH & Co. KG könne nicht ohne weiteres von einer Erweiterung der KG-Gesellschafterbefugnisse ausgegangen werden. Hierfür bedürfe es auch in diesem Fall einer entsprechenden Satzungsregelung. Nach diesen Grundsätzen hat die Gesellschafterversammlung der Komplementär-GmbH nach Ansicht des OLG Hamm hinsichtlich des Beschlusses, dass die monatlichen Entnahmen der Geschäftsführer bei der GmbH & Co. KG eine Tätigkeitsvergütung darstellen, ihre Kompetenz überschritten. Beschlüsse über Entnahmen aus dem Vermögen der GmbH & Co. KG waren nach dem Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co. KG von deren Gesellschafterversammlung zu fassen.
Weiter stellte das OLG Hamm fest, dass nach den vorstehenden Grundsätzen die Beauftragung eines Steuerberaters mit der Erstellung einer betriebswirtschaftlichen Analyse der KG als gewöhnliche Geschäftsführungsmaßnahme einzuordnen sei, die in den Kompetenzbereich der Komplementär-GmbH fällt. Ein dahingehender Beschluss durch die Komplementär-GmbH sei daher zulässig gewesen.
Voraussetzungen der gerichtlichen Anordnung einer Sonderprüfung
LG Frankfurt am Main, Beschluss vom 23. Februar 2016 – 3-16 O 2/15
In vorliegendem Verfahren beantragte eine Aktionärsvereinigung als Vertreterin einer Aktionärin die Anordnung einer gerichtlichen Sonderprüfung nach § 142 Abs. 2 AktG. Die Hauptversammlung der Antragsgegnerin, einer Aktiengesellschaft, hatte die Bestellung eines Sonderprüfers zuvor abgelehnt.
Das LG Frankfurt am Main lehnte den Antrag in der vorliegenden Entscheidung als unbegründet ab: Mit dem Antrag nach § 142 Abs. 2 AktG könne nur die Prüfung eines Vorgangs begehrt werden, der nach § 142 Abs. 1 S. 1 AktG Gegenstand einer von der Hauptversammlung angeordneten Sonderprüfung sein könnte. Zusätzlich müsse ein ablehnender Beschluss der Hauptversammlung vorliegen. Wegen der Subsidiarität der gerichtlichen Bestellung des Sonderprüfers gegenüber der gesellschaftsrechtlichen Zuständigkeitsordnung bedeute dies aber auch, dass Gegenstand eines Antrags nach § 142 Abs. 2 AktG inhaltlich im Wesentlichen nur der in der Hauptversammlung abgelehnte Sonderprüfungsantrag sein könne. Eine gerichtliche Bestellung könne demnach nur so erfolgen, wie sie bereits Gegenstand des in der Hauptversammlung gestellten Antrags war. Eine Erweiterung oder Änderung scheide aus. Dies führe aber dazu, dass bei einer einheitlichen ablehnenden Beschlussfassung der Hauptversammlung über einen Sonderprüfungsantrag auch nur eine Sonderprüfung hinsichtlich der gesamten Antragstellung, wie sie der Hauptversammlung auch vorlag, vom Gericht angeordnet werden könne und eine Beschränkung des Ausspruchs auf einzelne Teile nicht möglich sei.
Auch die Hauptversammlung habe nur die Möglichkeit gehabt, einheitlich über den ihr unterbreiteten Antrag zustimmend oder ablehnend zu entscheiden. Größere Kompetenzen könnten daher auch nicht dem Gericht im Verfahren nach § 142 Abs. 2 AktG zustehen. Nach der gesetzlichen Konzeption des § 142 AktG werde mit dem Institut der Sonderprüfung den Aktionären ein Mittel an die Hand gegeben, mit dem sie in Fällen der begründeten Annahme von Pflichtwidrigkeiten der Organe, abweichend von der üblichen Zuständigkeitsverteilung und weit über ihr übliches Auskunftsrecht hinaus, entweder in Ergänzung zum Aufsichtsrat oder an seiner Stelle Geschäftsführungsmaßnahmen des Vorstands oder die Tätigkeit des Aufsichtsrats selbst überprüfen lassen können. Nur aus Gründen des Minderheitenschutzes habe der Gesetzgeber hier die Möglichkeit einer gerichtlichen Anordnung auf Antrag einer Minderheit ausgesprochen, wenn die Hauptversammlung dem entsprechenden Antrag nicht gerecht wird. Würde man dem Gericht hier weitergehende Kompetenzen als der Hauptversammlung einräumen, würde dieses Regelungsgefüge nicht mehr bestehen. Das Gericht könne hier daher nur überprüfen und entscheiden, ob entgegen der Hauptversammlungsmehrheit aus besonderen Gründen des §142 Abs. 2 AktG die von der Hauptversammlungsmehrheit abgelehnte Sonderprüfung gleichwohl anzuordnen ist.
Weiter stellt das LG Frankfurt am Main klar, dass aus den vorgenannten Gründen ‑ entgegen der herrschenden Auffassung in der Literatur ‑ das Gericht nicht von dem bereits der Hauptversammlung vorgeschlagenen Sonderprüfer abweichen und einen anderen bestellen könne, da auch die Person des konkreten Sonderprüfers Gegenstand der einheitlichen Beschlussfassung der Hauptversammlung gewesen sei. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die ablehnende Beschlussfassung gegebenenfalls alleine auf dem Vorschlag des dortigen Sonderprüfers beruht habe. Würde man dem Gericht hier eine vom Vorschlag abweichende Bestellung zubilligen, so läge wiederum ein Eingriff in die Kompetenz der Hauptversammlung vor. Unstreitig sei jedoch der von der Antragstellerin vorgeschlagene Prüfer nach § 143 Abs. 2 S. 2 AktG in Verbindung mit § 319 Abs. 4 HGB als Prüfer ausgeschlossen, da ein Vorstandsmitglied des vorgeschlagenen Prüfers selbst Aktionär der Antragsgegnerin ist.
Die Antragstellerin kann sich nach Auffassung des LG Frankfurt am Main auch nicht darauf berufen, dass nach § 142 Abs. 4 AktG grundsätzlich die gerichtliche Ersetzung eines von der Hauptversammlung bestellten Prüfers möglich ist. Die gerichtliche Ersatzbestellung sei nur für den von der Hauptversammlung und nicht für einen gerichtlich bestellten Sonderprüfer anwendbar. Ein Austausch des gewollten Prüfers komme bei entsprechender Beschlussfassung der Hauptversammlung nur unter den Voraussetzungen des Abs. 4 S. 1 in Betracht. Eine Analogie zu § 318 Abs. 4 S. 2 HGB (gerichtliche Bestellung eines Abschlussprüfers bei Ablehnung oder Wegfall des Prüfungsauftrags) sei insofern auch nicht möglich. Die Schutzrichtung der in § 318 HGB angesprochenen Regelabschlussprüfung sei eine andere als die der korporationsintern veranlassten, punktuellen Sonderprüfung. Ziel des § 318 Abs. 4 HGB sei, die rechtzeitige Durchführung der Abschlussprüfung zu sichern. Damit solle die Vorschrift vor allem die Nichtigkeit des festgestellten Jahresabschlusses nach § 256 Abs. 1 Nr. 2 AktG verhindern. Dieser Gedanke ist auf Sonderprüfungen nach § 142 AktG nicht übertragbar. Demnach könne es aus Sicht des LG Frankfurt am Main auch nicht Aufgabe des Gerichts sein, eine fehlgeschlagene Sonderprüferbestellung analog § 318 Abs. 4 HGB aufzufangen.
Auskunftsanspruch des besonderen Vertreters
LG Heidelberg, Urteil vom 4. Dezember 2015 – 11 O 37/15 KfH
Das LG Heidelberg hatte sich in vorliegendem Verfahren mit der Rechtsstellung und dem Auskunftsanspruch eines durch Beschluss der Hauptversammlung berufenen besonderen Vertreters nach § 147 Abs. 2 S. 1 AktG zu befassen. Der Kläger war zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates der Gesellschaft als solcher bestellt worden und machte einen Anspruch auf Herausgabe verschiedener Unterlagen und Informationen gegen die Gesellschaft, vertreten durch ihren Vorstand, geltend.
Das LG Heidelberg räumte dem Kläger einen solchen Anspruch auf Information und Auskunft gemäß § 147 Abs. 1 S. 2 AktG in Verbindung mit den entsprechenden Hauptversammlungsbeschlüssen betreffend seine Berufung ein. Der besondere Vertreter nach § 147 Abs. 2 S. 1 AktG ist nach Ansicht des LG Heidelberg Organ der Gesellschaft, allerdings nur in seinem Aufgabenkreis. Daraus ergebe sich, dass ihm als Annexkompetenz aus § 147 Abs. 2 S. 1 AktG auch die Informations- und Auskunftsrechte zustehen, die ein Organ der Gesellschaft zur Verfolgung seiner Aufgabe hat. Zwar habe der besondere Vertreter kein umfassendes Prüfungsrecht; er sei kein „Sonderermittler“. Jedoch habe er innerhalb seines Aufgabenkreises durchaus ein umfassendes Informationsrecht. Eingeschränkt werde dieses Informationsrecht allerdings durch die sachliche Begrenzung auf seine Aufgabe, Ersatzansprüche bezüglich eines konkreten Lebensvorgangs geltend zu machen.
Weiter stellte das LG Heidelberg klar, dass für den Auskunftsanspruch des besonderen Vertreters nach § 147 AktG ein Anfangsverdacht für das Bestehen der geltend zu machenden Ersatzansprüche nicht erforderlich ist. Bereits die Würdigung, ob genügend Anhaltspunkte für einen sogenannten „Anfangsverdacht“ vorliegen, erfordere eine gewisse Sachaufklärung. Dies sei bei einer bestandskräftigen Bestellung des besonderen Vertreters nicht Sache des Gerichts. Sobald im Bestellungsbeschluss in einem ausreichenden Maße der Lebenssachverhalt konkret dargelegt sei, auf dem die Ersatzansprüche gestützt werden, sei der Aufgabenkreis des besonderen Vertreters ausreichend bestimmt und damit auch die sich in diesem Zusammenhang für ihn ergebenden Rechte und Pflichten bestimmbar. Innerhalb dieses Aufgabenkreises habe der besondere Vertreter grundsätzlich die Pflicht, etwaige Ersatzansprüche geltend zu machen.
Letztlich stellt das LG Heidelberg fest, dass der vorstehend beschriebene Auskunftsanspruch dem Kläger als besonderem Vertreter gegen die Gesellschaft, vertreten durch den Vorstand, zusteht. Da der besondere Vertreter in seinem Aufgabenkreis Organ der Gesellschaft ist, verdrängt er dort die anderen Organe, insbesondere Vorstand oder Aufsichtsrat. Entsprechend könne er gegen die Gesellschaft die erforderlichen Ansprüche erheben. Der besondere Vertreter nehme seine Rechte und Pflichten für die Gesellschaft in seinem Aufgabenkreis wahr und müsse daher seine Ansprüche gegen die Gesellschaft geltend machen, in deren Interesse er tätig wird. Eine „Durchgriffshaftung“ der Organe der Gesellschaft bestehe nicht.
Besonderer Vertreter und Sonderprüfung, Abwahl eines Versammlungsleiters
LG Köln, Urteil vom 14. Januar 2016 – 91 O 31/15
Das LG Köln hatte sich vorliegend unter anderem mit Abgrenzungsfragen um die Beschlussfassung der Hauptversammlung nach § 147 Abs. 1 AktG zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen sowie um die Bestellung eines besonderen Vertreters nach § 142 AktG zu befassen. Zudem hatte das LG Köln den Beschluss über die Abwahl des Versammlungsleiters zu würdigen. Das Verfahren betrifft die ordentliche Hauptversammlung der Strabag AG in 2015. Minderheitsaktionäre hatten im Vorfeld der Hauptversammlung eine Ergänzung der Tagesordnung um einen Beschluss zur Bestellung eines Sonderprüfers nach § 142 AktG sowie zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen nach § 147 AktG und zur Bestellung eines besonderen Vertreters durchgesetzt.
Das LG Köln stellte zunächst (insofern ergänzend zum vorstehenden Urteil des LG Heidelberg) fest, dass für eine Beschlussfassung nach § 147 Abs. 1 AktG erforderlich ist, dass zumindest tatsächliche Anhaltspunkte für ein schadenersatzbegründendes Verhalten des in Anspruch zu nehmenden Haftungsschuldners bestehen. Es soll nach Ansicht des Gerichts nicht ausreichen, wenn ‑ wie im vorliegenden Fall ‑ lediglich gleichsam ins Blaue hinein ein haftungsbegründendes Verhalten der in Aussicht genommenen Haftungsschuldner ohne jeglichen konkreten Anhaltspunkt behauptet wird. Der Verzicht auf ein solches, vordergründig den Wortlaut des § 147 Abs. 1 AktG einschränkendes Merkmal, würde nach Auffassung des LG Köln das System des Minderheitenschutzes der §§ 147, 142 AktG sowie der §§ 311 ff. AktG negieren. Im siebenten Unterabschnitt des Vierten Abschnitts regele das Aktiengesetz, auf welche Weise (Minderheits-) Aktionäre auch gegen den Willen der Verwaltung oder gegebenenfalls eines Mehrheitsaktionärs Unredlichkeiten aufklären und gegebenenfalls daraus resultierende Ansprüche durchsetzen können. In erster Linie stelle das Gesetz hierfür das Instrument der Sonderprüfung zur Verfügung, um einen im Einzelnen noch unklaren Sachverhalt bei Bestehen eines Verdachts auf unredliches Verhalten (unter anderem) der Geschäftsführung aufklären zu lassen. Ergänzt werde die Regelung durch § 258 AktG, der eine Bestellung der Sonderprüfer für den Fall vorsieht, dass Anlass für die Annahme einer unzulässigen Unterbewertung einzelner Posten im Jahresabschluss besteht. Ergänzt werde die Regelung ferner durch § 315 AktG, der gerade für Konzernsachverhalte wie den vorliegenden ein weitergehendes Sonderprüfungsrecht für den Fall vorsieht, dass sonstige Tatsachen vorliegen, die den Verdacht einer pflichtwidrigen Nachteilszufügung rechtfertigen. Bereits die Existenz des § 142 AktG zeige, dass es bei § 147 AktG um die Geltendmachung bereits bekannter Ansprüche geht. Wollte man nämlich dem besonderen Vertreter nach § 147 Abs. 2 S. 1 AktG eine umfassende Prüfungskompetenz des Inhalts zuerkennen, erst im Einzelnen die Voraussetzungen der in § 147 Abs. 1 AktG aufgeführten Ansprüche zu ermitteln, bedürfte es der Regelung des § 142 AktG nicht. Das Institut des Sonderprüfers wäre überflüssig. Der besondere Vertreter in § 147 Abs. 2 S. 1 AktG wäre zugleich Sonderprüfer. Für diese Sichtweise spreche auch die Sechsmonatsfrist in § 147 Abs. 1 S. 2 AktG. Der Gesetzgeber gehe ersichtlich davon aus, dass die tatsächlichen Grundlagen des Anspruchs bei § 147 AktG bereits weitestgehend geklärt sind und eine der Geltendmachung vorangehende Ermittlung der Anspruchsvoraussetzungen im Einzelnen nicht erforderlich ist. Die Frist von sechs Monaten wäre ansonsten bei komplexen Sachverhalten in aller Regel nicht einzuhalten.
Das Verhältnis der §§ 147 und 142 AktG zueinander habe Auswirkungen auch auf die an einen Beschluss nach § 147 AktG zu stellenden Anforderungen. Dabei gehe es zum einen um die hinreichende Bestimmtheit des Beschlussantrags, die es ermöglichen soll festzustellen, ob der später von dem besonderen Vertreter geltend gemachte Anspruch mit demjenigen identisch ist, der Gegenstand des Hauptversammlungsbeschlusses ist. Insoweit bestehen aus Sicht des LG Köln vorliegend keine Bedenken, denn die Anknüpfung in den Beschlussanträgen an bestimmte konzerninterne Geschäfte und die Benennung der potentiellen Anspruchsgegner dürften hinreichend sicher die Feststellung ermöglichen, ob die später geltend zu machenden Ansprüche hiermit identisch sind.
Erforderlich ist aber nach Auffassung des LG Köln darüber hinaus, dass die Beschlussfassung nach § 147 AktG auf der Grundlage eines Sachverhalts erfolgt, aus dem sich der geltend zu machende Anspruch schlüssig ergibt, jedenfalls aber eine konkrete Wahrscheinlichkeit hierfür besteht. Komme nämlich dem besonderen Vertreter allein die Aufgabe zu, einen der Gesellschaft zustehenden Anspruch geltend zu machen, so müsse dieser Anspruch in seinen wesentlichen Elementen, also Gläubiger, Schuldner und Anspruchsgrund, bekannt sein. Bei der Geltendmachung von Ansprüchen wegen pflichtwidrigen schädigenden Verhaltens gehöre dazu zumindest auch ein Sachverhalt, aus dem sich eben diese Pflichtwidrigkeit und der Schaden ergeben. Ist Letzteres nicht bekannt, stelle das Gesetz wie ausgeführt die Möglichkeit einer Sonderprüfung zur Verfügung.
Im Hinblick auf die ebenfalls während der Hauptversammlung streitige Versammlungsleitung stellte das LG Köln fest, dass der Beschluss der Hauptversammlung, in dem die Abwahl des Versammlungsleiters abgelehnt wurde, fehlerhaft ist. Der Versammlungsleiter habe die Hauptversammlung nicht leiten dürfen, weil die Schadensersatzansprüche, wegen derer die Minderheitsaktionäre die Durchführung einer Sonderprüfung sowie vor allem einen Beschluss nach § 147 Abs.1 AktG herbeiführen wollten, sich auch gegen ihn richten sollten und er daher befangen gewesen sei. Aus diesem Grund habe ein wichtiger Grund für seine Abwahl als Versammlungsleiter bestanden und die Mehrheitsaktionärin wäre aus ihrer gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht gehalten gewesen, für eine Abwahl zu stimmen. Ein wichtiger Grund für die Abwahl des Versammlungsleiters liegt aus Sicht des LG Köln grundsätzlich vor, wenn feststeht, dass er seine Pflichten nicht erfüllen kann oder will, insbesondere weil auch gegen ihn Ersatzansprüche von der Gesellschaft geltend gemacht werden sollen.
Gesetzgebung
Insolvenzanfechtungsreform
Am 24. Februar 2016 fand im Bundestagsausschuss für Recht und Verbraucherschutz eine öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der Insolvenzordnung und nach dem Anfechtungsgesetz (vgl. Noerr Newsletter Ausgabe November 2015) statt. Der Gesetzentwurf verfolgt ausweislich der Gesetzbegründung das Ziel, den Wirtschaftsverkehr sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Rechtsunsicherheiten zu entlasten, die von der derzeitigen Praxis des Insolvenzanfechtungsrechts ausgehen. Zudem sollen die unter dem geltenden Recht gewährten Möglichkeiten der Insolvenzanfechtung punktuell neu justiert und das Gläubigerantragsrecht gestärkt werden, um übermäßige Belastungen des Geschäftsverkehrs sowie von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu vermeiden.
Hauptkritikpunkt der Sachverständigen im Rahmen der Anhörung war das durch die Änderung in § 131 Abs. 1 S. 2 InsO-E geplante (faktische) Fiskusprivileg. Die vorgesehene Regelung sieht eine Anfechtungsverschonung von Rechtshandlungen vor, wenn sie allein „durch Zwangsvollstreckung erwirkt oder zu deren Abwendung bewirkt worden“ sind. Nach Ansicht mehrerer Sachverständigen würde diese Regelung im Ergebnis zu einem nicht gewollten Wettlauf der Gläubiger und einer Bevorzugung öffentlicher Gläubiger wie Finanzbehörden und Sozialversicherungsträger als sogenannte Selbsttitulierer führen.
Meldung des Bundestags; Liste und Stellungnahmen der Sachverständigen
Reform der Abschlussprüfung
Am 22. Februar 2016 fand im Rechtsausschuss des Bundestages eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf zur Umsetzung der prüfungsbezogenen Regelungen der Richtlinie 2014/56/EU sowie zur Ausführung der entsprechenden Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 im Hinblick auf die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse (Abschlussprüfungsreformgesetz - AReG) (vgl. Noerr Newsletter Ausgabe Januar 2016) statt. Der Entwurf stieß weitgehend auf Zustimmung. Kritik wurde von einigen Sachverständigen an der Verpflichtung der betroffenen Unternehmen zum Wechsel der Abschlussprüfer nach regelmäßig zehn Jahren, geübt. Es sei beispielsweise nicht auszuschließen, dass diese Rotationspflicht auch zu einer Beeinträchtigung der Qualität der Abschlussprüfung führen könne, da mit jedem Prüferwechsel auch Sachwissen und Erfahrung verloren gehe. Kritisiert wurde auch einer Regelung zur Berichtspflicht des Aufsichtsrats gegenüber der Hauptversammlung für den Fall, dass der Aufsichtsrat selbst die Aufgabe des Prüfungsausschusses wahrnimmt. Die Hauptversammlung habe weder die Aufgabe noch die Hilfsmittel, eine solche Überwachungsfunktion wahrzunehmen.
Meldung des Bundestags
Am 17. März 2016 hat der Bundestag in zweiter und dritter Lesung den Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung des Bundestagsausschusses für Recht und Verbraucherschutz verabschiedet.
Änderungen des Gesetzentwurfs in der Beschlussempfehlung im Vergleich zum Regierungsentwurf betreffen neben redaktionellen Präzisierungen unter anderem in § 324 Abs. 2 S. 2 HGB-E eine Konkretisierung der Sachkunde der Mitglieder des Prüfungsausschusses. Insofern müssen die Mitglieder in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem das Unternehmen tätig ist, vertraut sein. Die Mehrheit der Mitglieder, darunter der Vorsitzende, muss unabhängig sein und mindestens ein Mitglied muss über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen. Diese Anforderungen sollen nach den Übergangsbestimmungen jedoch so lange keine Anwendung finden, wie alle Mitglieder des Prüfungsausschusses vor dem 17. Juni 2016 bestellt worden sind. Auch wird in § 319a Abs. 3 HGB-E klargestellt, dass eine vorherige Zustimmung des Prüfungsausschusses zur Erbringung von Steuerberatungsleistungen durch den Abschlussprüfer erforderlich ist. Diese Beratungsleistungen sollen nicht erst nachträglich genehmigt werden können. Die in § 171 Abs. 2 S. 4 AktG-E ursprünglich vorgesehene und in der Sachverständigenanhörung kritisierte Ergänzung der Berichtspflicht des Aufsichtsrats gegenüber der Hauptversammlung für den Fall, dass der Aufsichtsrat als Ganzes die Aufgaben des Prüfungsausschusses wahrnimmt, wurde im Rahmen der Ausschussberatungen gestrichen.
Meldung des Bundestags
Erstes Finanzmarktnovellierungsgesetz
In seiner Sitzung am 26. Februar 2016 hat der Bundesrat eine Stellungnahme zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer Rechtsakte (Erstes Finanzmarktnovellierungsgesetz – 1. FimanoG) (vgl. Noerr Newsletter Ausgabe Januar 2016) beschlossen.
Der Bundesrat machte im Rahmen dieser Stellungnahme auf eine im Gesetzentwurf angelegte doppelte Zuständigkeit von Länderbehörden (Börsenaufsicht) und Bundesbehörde (BaFin) für Kernbereiche der Börsenaufsicht aufmerksam. Diese würde zwangsläufig zu rechtlichen und praktischen Problemen führen und sei verfassungsrechtlich bedenklich. Es sei daher zu überlegen, Börsen beziehungsweise Betreiber von Börsen aus dem Anwendungsbereich der Regelungen herauszunehmen. Vor dem Hintergrund, dass Bußgelder durch den Gesetzentwurf erheblich angehoben werden, soll aus Sicht des Bundesrats unbedingt sichergestellt werden, dass sich Unternehmen diesen Geldbußen nicht durch Unternehmensumstrukturierung ‑ ebenso wie dies in der Vergangenheit im Hinblick auf vom Bundeskartellamt verhängten Bußgeldern der Fall war ‑ entziehen können. Auch bittet der Bundesrat zu prüfen, ob und inwiefern Erleichterungen bei der Erstellung von Produktinformationsblättern für einfache Finanzinstrumenten möglich sind, wie z. B. börsennotierte Aktien oder Bundesanleihen, von der Verpflichtung nach § 31 Abs. 3a WpHG, ein Produktinformationsblatt über jedes Finanzinstrument zur Verfügung zu stellen.
Meldung des Bundestags
Am 14. März 2016 fand im Finanzausschuss des Bundestags eine Sachverständigenanhörung statt. Die Sachverständigen forderten den Gesetzgeber unter anderem auf, über die europäischen Vorgaben hinaus nationale Sondervorschriften abzuschaffen. Insbesondere aus Sicht der Kreditwirtschaft sei bei einfachen Produkten wie Aktien und einfachen Schuldverschreibungen ein besonderer Schutz der Anleger nicht erforderlich, wie dies auch bereits vom Bundesrat angedeutet wurde. Zum Teil wurden weitergehende Befugnisse der BaFin bei der Bekämpfung von Marktmissbrauch gefordert, um einen effektiven Schutz von Kleinanlegern zu sichern. Ebenso wie der Bundesrat dies getan hat, wurde in der Sachverständigenanhörung auch die Beibehaltung der systematischen Trennung der Zuständigkeiten für Wertpapieraufsicht bei der BaFin und der Börsenaufsicht bei den Landesbehörden gefordert, um einen Eingriff in den eigenständigen Kompetenzbereich der Bundesländer zu verhindern.
Meldung des Bundestags, Liste und schriftliche Stellungnahmen der Sachverständigen
Stellungnahme zum Vorschlag zur Änderung der europäischen Prospektrichtlinie
In seiner Sitzung am 26. Februar 2016 hat der Bundesrat eine Stellungnahme zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist (vgl. Noerr Newsletter Ausgabe Dezember 2015), beschlossen. Die Stellungnahme beinhaltet insbesondere die folgenden Aspekte:
-
Die Anforderungen an die Verständlichkeit des Prospekts und die Prospektzusammenfassung sollen weiter konkretisiert werden. Insbesondere sollte als Maßstab der Verständnishorizont von in Finanzangelegenheiten durchschnittlich gebildeten und informierten Verbraucherinnen und Verbrauchern herangezogen werden.
-
Die Einführung eines „einheitlichen Registrierungsformulars“ mit Erlass einer Genehmigung bzw. Billigung desselben, wenn in drei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren ein einheitliches Registrierungsformular des Emittenten von der zuständigen nationalen Behörde gebilligt wurde, birgt aus Sicht des Bundesrats das Risiko, dass Angaben im einheitlichen Registrierungsformular über die Zeit hinweg unvollständig, unverständlich oder widersprüchlich werden und dies mangels Billigung nicht von der zuständigen Behörde entdeckt wird. Daher schlägt er eine zwingende Billigung zumindest jedes zweite Jahr vor.
-
Die die gesetzliche Prospekthaftung in Deutschland prägende Vermutung der Ursächlichkeit eines Prospektmangels für die Anlageentscheidung soll aus Sicht des Bundesrats erhalten bleiben. Hierfür soll sich die Bundesregierung bei den Verhandlungen des Verordnungsvorschlags einsetzen.
-
Die Beschränkungen der Haftung für Mängel der Prospektzusammenfassung sollen überprüft werden. Die derzeitige Regelung werde der Bedeutung der Prospektzusammenfassung als wesentlicher Informations- und Entscheidungsgrundlage nicht gerecht.
Möchten Sie diesen Noerr-Newsletter künftig per E-Mail beziehen? Klicken Sie auf der rechten Seite auf 'jetzt anmelden'.
Dieser Newsletter dient lediglich der allgemeinen Information. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann eine rechtliche oder steuerliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität.
Dieser Newsletter enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist der jeweilige Betreiber verantwortlich.
Archiv:
- Corporate-Newsletter Februar 2016
- Corporate-Newsletter Januar 2016
- Corporate-Newsletter Dezember 2015
- Corporate-Newsletter November 2015
- Corporate-Newsletter Oktober 2015
- Corporate-Newsletter September 2015
- Corporate-Newsletter Juli 2015
- Corporate-Newsletter Juni 2015
- Corporate-Newsletter Mai 2015
- Corporate-Newsletter April 2015
- Corporate-Newsletter März 2015
- Corporate-Newsletter Februar 2015
- Corporate-Newsletter Januar 2015