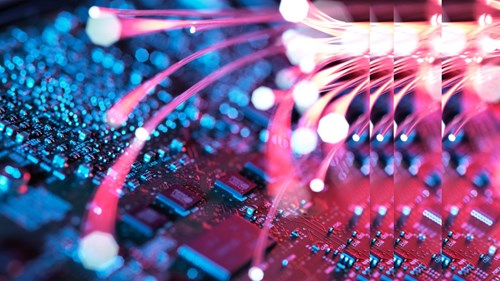Überblick Rechtsprechung im Gesellschaftsrecht 03/2017
Ende der Verbriefung des Barabfindungsanspruchs
BGH, Urteil vom 31. Januar 2017 – II ZR 285/15
Die Klägerin ist Inhaberin von 13 auf den Inhaber ausgestellten Aktienurkunden einer Aktiengesellschaft und beansprucht unter Vorlage der Aktienurkunden eine weitergehende Barabfindung nach einem Ausschluss von Minderheitsaktionären (Squeeze-out). Die Beklagte war Hauptaktionärin einer Aktiengesellschaft, deren Hauptversammlung im Juli 2002 den Ausschluss der Minderheitsaktionäre beschloss. Im anschließenden Spruchverfahren schlossen mehrere Minderheitsaktionäre mit der Beklagten einen Teilvergleich, der eine Erhöhung der Barabfindung vorsah und als echter Vertrag zugunsten Dritter für alle ehemaligen Minderheitsaktionäre gelten sollte. Die Klägerin begehrt Zahlung des in dem Teilvergleich vereinbarten Erhöhungsbetrags auf Basis der vorgelegten Aktienurkunden. Diese tragen auf der Rückseite einen von der Beklagten aufgebrachten Stempelaufdruck mit dem Text: „Ungültig wegen Squeeze-out Barabfindung erhalten“. Das LG Koblenz hat der Klage erstinstanzlich stattgegeben, das Berufungsgericht hat sie abgewiesen.
Der BGH wies die Revision ab. Er lehnte eine sich aus § 327e Abs. 3 S. 2 AktG ergebende Anspruchsberechtigung der Klägerin als Inhaberin der vorgelegten Aktienurkunden ab. Der BGH stellte zunächst klar, dass grundsätzlich gemäß § 327e Abs. 3 S. 2 AktG nach Eintragung des zum Ausschluss der Minderheitsaktionäre gefassten Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister und dem hierdurch bewirkten Übergang der Mitgliedschaft auf den Hauptaktionär die Aktienurkunden den vollen Barabfindungsanspruch des früheren Minderheitsaktionärs einschließlich einer etwaigen Differenz zwischen der vom Hauptaktionär festgelegten und der in einem nachfolgenden Spruchverfahren ermittelten (höheren) Barabfindung verbriefen. Mit dem „Anspruch auf Barabfindung“ sei eine Abfindung gemeint, die den „wirklichen“ oder „wahren“ Wert des Anteilseigentums widerspiegelt. Dieser beinhalte auch etwaige Nachbesserungen im Spruchverfahren.
Die Aktienurkunden verbriefen den Barabfindungsanspruch gemäß § 327e Abs. 3 S. 2 AktG nach Ansicht des BGH jedoch nur bis zu ihrer Aushändigung an den Hauptaktionär. Die ausgeschiedenen Minderheitsaktionäre seien zur Herausgabe der ihren Abfindungsanspruch verbriefenden Urkunden nur gegen Zahlung der Barabfindung verpflichtet. Durch die Aushändigung oder die Zahlung erlange der Hauptaktionär das Eigentum an den Aktienurkunden und die durch § 327e Abs. 3 S. 2 AktG angeordnete Verbriefung des Abfindungsanspruchs ende.
Die Aushändigung der Aktienurkunden gemäß § 327e Abs. 3 S. 2 AktG ist aus Sicht des BGH allerdings von einer bloßen Vorlage der Aktienurkunden zum Zweck des Erhalts einer Teilleistung zu unterscheiden. Entspreche die vom Hauptaktionär festgelegte Barabfindung nicht der angemessenen Abfindung, die der ehemalige Minderheitsaktionär beanspruchen kann, so sei dieser nicht verpflichtet, dem Hauptaktionär die Aktienurkunden auszuhändigen, um die in der festgelegten Abfindung liegende bloße Teilleistung zu erhalten. Er müsse lediglich die Anbringung eines Teilzahlungsvermerks auf der in seinem Eigentum verbleibenden Urkunde dulden. Händige der ehemalige Minderheitsaktionär aber dennoch dem Hauptaktionär Aktienurkunden aus, um ihn zur Auszahlung der festgelegten (möglicherweise aber nicht angemessenen) Abfindung zu veranlassen, so ende auch durch eine solche Aushändigung die Legitimationswirkung zugunsten des ehemaligen Minderheitsaktionärs. Der Anspruch auf die (mögliche) Differenz zur vollen Abfindung bleibe ihm aber erhalten, ohne dass es eines entsprechenden Vorbehalts bedürfte. Der ausgeschiedene Minderheitsaktionär könne in diesem Fall von dem Hauptaktionär die Erteilung einer Quittung verlangen, die ihn als ehemaligen Inhaber der ausgehändigten Aktienurkunden ausweist und ihm so die Möglichkeit gibt, seine frühere Aktionärsstellung in einem etwaigen Spruchverfahren zu belegen.
Vorliegend habe das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei die Aushändigung der in Rede stehenden Aktienurkunden an die Beklagte angenommen, mit der Folge, dass die Urkunden keinen Ergänzungsanspruch als Teil eines Anspruchs auf angemessene Barabfindung mehr verbriefen. Der Umstand, dass die Beklagte auf den Aktienurkunden den Stempelaufdruck „Ungültig wegen Squeeze-out Barabfindung erhalten“ anbringen konnte und angebracht hat, belege, dass eine Aushändigung zum Zwecke der Auszahlung der festgesetzten Barabfindung stattgefunden hat und die Aktien nicht etwa aus einem anderen Grund wie etwa zur Verwahrung oder Verpfändung übergeben wurden. Die von der Klägerin vorgelegten, mit einer „Ungültig“-Stempelung der Beklagten versehenen Aktienurkunden verbriefen infolgedessen nicht (mehr) den Anspruch auf die im Teilvergleich festgelegte Abfindungsergänzung. Auch habe die Klägerin keinen ausreichenden anderweitigen Nachweis erbracht, dass sie im Zeitpunkt der Eintragung des Übertragungsbeschlusses im Handelsregister Minderheitsaktionärin war oder den Abfindungsanspruch durch Abtretung erworben hat.
Einlagenrückgewähr durch Besicherung eines Darlehensanspruchs
BGH, Urteil vom 10. Januar 2017 – II ZR 94/15
Der Kläger ist Insolvenzverwalter einer AG, deren Vorstandsmitglieder die ursprünglichen beiden Beklagten waren. Vor dem Börsengang der AG im Jahr 1998 bot diese ihren Mitarbeitern sowie ausgewählten Handelsvertretern eines Vertriebsunternehmens die bevorrechtigte Zeichnung von Aktien an. Die D Bank AG, Nebenintervenientin aufseiten des Klägers, gewährte zahlreichen Aktienerwerbern Darlehen zur Finanzierung der jeweiligen Kaufpreise für die Aktien gegen Verpfändung der Aktien. Zahlreiche Aktienerwerber hatten weder genügend Eigenkapital für den Kauf von Aktien noch konnten sie die für eine Fremdfinanzierung erforderliche bankübliche Sicherheit stellen. Zur Besicherung dieser Darlehen verpfändeten die Beklagten Kontoguthaben einer von ihnen beherrschten Aktionärin der insolventen AG. Nach Eintritt der Fälligkeit der Darlehen im Januar 1999 wurde für ca. die Hälfte der Kreditnehmer die Finanzierung um ein halbes Jahr verlängert. Die insolvente AG stellte jetzt jedoch selbst die Sicherheit für die Darlehen. Hierzu verpfändeten die Beklagten in Vertretung der AG zu deren Vermögen gehörende Kontoguthaben. Nach Kursverlusten forderte die darlehensgebende Nebenintervenientin im April 2001 die noch verbliebenen Kreditnehmer zur Darlehensrückzahlung auf und befriedigte sich im Mai 2001 wegen der Außenstände aus den durch die insolvente AG gestellten Sicherheiten. Der Kläger verlangt mit der Begründung, die Bestellung einer Sicherheit durch die AG habe gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr verstoßen, von den Beklagten als Gesamtschuldner Zahlung des von der Nebenintervenientin aus der Befriedigung erlangten Betrags. Das LG Marburg wies die Klage in erster Instanz ab. Das OLG Frankfurt am Main als Berufungsinstanz hielt die Klage dem Grunde nach für gerechtfertigt.
Der BGH folgte dem Berufungsgericht und wies die Revision des im Revisionsverfahren nach einem Vergleich mit dem zweiten Beklagten noch verbliebenen einen Beklagten zurück. Der Beklagte sei der Schuldnerin wegen einer unzulässigen Einlagenrückgewähr gemäß § 93 Abs. 3 Nr. 1, Abs. 2 S. 1 AktG zum Ersatz verpflichtet. Die Besicherung der von den Aktionären verlängerten Darlehen durch die Verpfändung von Kontoguthaben der insolventen AG sei eine nach § 57 Abs. 1 AktG verbotene Einlagenrückgewähr. Das Verbot der Einlagenrückgewähr nach § 57 Abs. 1 S. 1 AktG erfasse jede von der Gesellschaft dem Aktionär erbrachte, auf seiner Gesellschafterstellung beruhende Leistung, auf die ihm das Aktiengesetz keinen Anspruch gewährt und die auch nicht aufgrund einer speziellen gesetzlichen Regelung zugelassen ist. Die Bestellung einer dinglichen Sicherheit für ein Darlehen des Aktionärs bei einem Dritten sei eine solche „Auszahlung“ an den Aktionär. Bereits mit der Bestellung einer dinglichen Sicherheit wie hier der Verpfändung des Kontoguthabens an einen gesellschaftsfremden Dritten für ein Darlehen des Aktionärs und nicht erst mit der Verwertung liege die Einlagenrückgewähr vor. Die übrigen Gläubiger hätten im Umfang der Sicherheit keinen Zugriff mehr auf das Vermögen der Aktiengesellschaft, die die Verwertung zugunsten des Sicherungsnehmers bei Fälligkeit auch nicht verhindern könne.
Aus Sicht des BGH konnte eine verbotene Einlagenrückgewähr mangels eines vollwertigen Gegenleistungs- oder Rückgewähranspruchs gegen den Aktionär auch nicht wegen § 57 Abs. 1 S. 3 AktG verneint werden. Wenn ‑ wie hier ‑ der Rückzahlungsanspruch des Sicherungsnehmers für ein an den Aktionär ausgereichtes Darlehen besichert wird, sei der „Gegenleistungs- oder Rückzahlungsanspruch“ entsprechend den Grundsätzen bei der Ausreichung eines Darlehens durch die Gesellschaft unmittelbar an den Aktionär vollwertig, wenn nach einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung ein Forderungsausfall für den Darlehensrückzahlungsanspruch unwahrscheinlich ist. Dies hat das Berufungsgericht nach Ansicht des BGH im vorliegenden Fall jedoch zutreffend abgelehnt. Zwar habe das Berufungsgericht nicht jeden Mitarbeiter oder Handelsvertreter als Darlehensnehmer einzeln betrachtet, sondern die Bonität der Darlehensnehmer typisierend beurteilt. Dagegen bestünden angesichts der Typengleichheit der Geschäfte aber revisionsrechtlich keine Bedenken. Das Berufungsgericht habe rechtsfehlerfrei festgestellt, dass die Darlehensnehmer auf Fremdmittel angewiesen waren, weil ihnen der Aktienerwerb mit eigenen Mitteln nicht möglich gewesen wäre, und dass sie auch nicht vorrangige eigene bankübliche Sicherheiten stellen konnten.
Unerheblich sei insofern, dass die Kreditnehmer ihre Aktiendepots verpfändet hatten und für die Vollwertigkeit des Gegenleistungs- oder Rückzahlungsanspruchs deshalb maßgebend gewesen sein könnte, ob der Wert der finanzierten Aktien die Darlehensverbindlichkeiten deckte. Der Sicherungsfall habe zwar nicht eintreten können, wenn der Marktwert der Aktien zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Darlehensrückzahlungsanspruchs noch zu seiner Deckung genügte. Auf einen bleibenden oder steigenden Kurswert der Aktien hätten die Beklagten nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtung aber nicht vertrauen können, da es sich um ein spekulatives Geschäft gehandelt habe. Dass die Aktien als Sicherheit für den Darlehensrückzahlungsanspruch der Nebenintervenientin dienten, habe schon in der Konzeption des Aktienerwerbs durch die Mitarbeiter gelegen. Es sei von vornherein vorgesehen gewesen, dass sie mit dem Erlös aus dem Verkauf das Darlehen tilgen. Die zusätzliche Besicherung durch die AG habe damit das konkret bestehende Ausfallrisiko bei einer ungünstigen Kursentwicklung abgedeckt, die jederzeit möglich gewesen sei. Daraus folge, dass es nicht auf den aktuellen Wert der Aktien bei der Bestellung der Sicherheit ankam, sondern auf die voraussichtliche künftige Wertentwicklung. Angesichts der verzeichneten Kursrückgänge konnte das Berufungsgericht richtigerweise bei einem jungen Unternehmen wie der fraglichen AG bei vernünftiger kaufmännischer Betrachtung nicht davon ausgehen, dass ein weiterer Kursrückgang und damit ein Forderungsausfall der Nebenintervenientin unwahrscheinlich war.
Der BGH verneinte auch eine Zulässigkeit der Besicherung nach § 57 Abs. 1 S. 2 AktG i.V.m. § 71a Abs. 1 S. 2 Halbs. 1 AktG. Die Privilegierung erfasse nach ihrem Sinn und Zweck auch die Besicherung des Erwerbs von Aktien durch Dritte gemäß § 71a Abs. 1 S. 2 Halbs. 1 AktG, wenn die Besicherung einer Einlagenrückgewähr im Sinn von § 57 Abs. 1 AktG entspricht. Die Privilegierung nach § 71a Abs. 1 S. 2 AktG setze voraus, dass zum Zwecke des Erwerbs von Belegschaftsaktien eine Sicherheit geleistet wird. Zutreffend habe das Berufungsgericht eine Besicherung „zum Zweck“ des Erwerbs von Aktien verneint. Der BGH ließ offen, ob die Bestellung einer Sicherheit nicht mehr zum Zweck des Erwerbs im Sinn des § 71a Abs. 1 S. 1 und 2 AktG geschieht, wenn sie dem Aktienerwerb nachfolgt. Er ließ ebenfalls offen, ob der originäre Aktienerwerb überhaupt von § 71a AktG a.F. erfasst wird und ob es sich bei dem teilweise angesprochenen Erwerberkreis der Handelsvertreter um Arbeitnehmer im Sinne des § 71a AktG handelt. Denn jedenfalls fehle vorliegend bei der Sicherheitenbestellung der erforderliche Zusammenhang mit dem Erwerb. Allein dass die Finanzierungshilfe in irgendeiner Weise dem „Behalt“ der Aktien dient, genüge hierzu nicht, weil die Unterstützung eines zahlungsschwachen Aktionärs, der ansonsten seine Anteile verkaufen müsste, nicht mehr im Zusammenhang mit dem Erwerb der Aktien stehe. Dabei sei insbesondere maßgeblich, dass im ursprünglichen Erwerbsplan nicht vorgesehen gewesen sei, dass die Anfangsfinanzierung nur als Zwischenfinanzierung anzusehen und danach eine Anschlussfinanzierung durch die Gesellschaft vorzunehmen sei.
Geschäftsführer der Komplementär-GmbH als nahestehende Person der GmbH & Co. KG
BGH, Versäumnisurteil vom 22. Dezember 2016 – IX ZR 94/14
Der Kläger ist Insolvenzverwalter im Insolvenzverfahren über das Vermögen einer GmbH. Die Beklagte ist eine GmbH & Co. KG, deren Alleingesellschafterin und Geschäftsführerin ihrer Komplementär-GmbH die Ehefrau des Geschäftsführers der insolventen GmbH ist. Auf der Grundlage von monatlichen Rechnungen zahlte die insolvente GmbH insgesamt über EUR 100.000 an die Beklagte. Schriftliche Aufträge oder Leistungsbeschreibungen lagen den Rechnungen nicht zugrunde. Der Kläger nimmt die Beklagte unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der Insolvenzanfechtung auf Rückgewähr eines Teilbetrags von EUR 50.000 in Anspruch. Die Klage wurde in den Vorinstanzen vom LG und OLG Bremen abgewiesen.
Die Revision vor dem BGH hatte Erfolg. Der BGH stellte fest, dass mit der Begründung des Berufungsgerichts ein Anspruch des Klägers wegen vorsätzlicher Benachteiligung nach § 133 InsO nicht verneint werden könne. Es sei insbesondere nicht auszuschließen, dass die Beklagte eine der Insolvenzschuldnerin im Rechtssinne nahestehende Person ist: Welche Personen als nahestehend gelten, bestimme § 138 InsO und bei einer juristische Person als Insolvenzschuldnerin konkret § 138 Abs. 2 InsO. Diese Norm bezeichne in Nr. 1 unter anderem die Mitglieder des Vertretungsorgans des Insolvenzschuldners als nahestehende Personen, also vorliegend der Geschäftsführer der insolventen GmbH. Nach § 138 Abs. 2 Nr. 3 InsO gelten als nahestehend auch Personen, die zu einer der in Nr. 1 bezeichneten Personen in einer in Abs. 1 bezeichneten persönlichen Verbindung stehen. Diese Voraussetzungen treffen auf die Ehefrau nicht nur als die Alleingesellschafterin und Geschäftsführerin der Komplementär-GmbH zu, die als Ehefrau des Geschäftsführers der Schuldnerin unter § 138 Abs. 1 Nr. 1 InsO fällt, sondern ‑ entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ‑ auch auf die beklagte GmbH & Co. KG. Diese stehe zum Geschäftsführer der Insolvenzschuldnerin in der in § 138 Abs. 1 Nr. 4 InsO beschriebenen Verbindung. Der BGH stellte fest, dass sich die früher überwiegend vertretene Auffassung, wonach die Regelung in § 138 Abs. 2 Nr. 3 InsO nur natürliche und nicht juristische Personen erfasse, nach der am 1. Juli 2007 in Kraft getretenen Neufassung des § 138 InsO durch das Gesetz zur Vereinfachung des Insolvenzverfahrens vom 13. April 2007 (BGBl. I S. 509, 510) nicht mehr vertreten lasse. Der Gesetzgeber habe erkannt, dass in Absatz 1 nicht geregelt war, unter welchen Voraussetzungen Gesellschaften einer natürlichen Person nahestehen. Um diese Lücke zu schließen, sei die neue Bestimmung Nr. 4 eingefügt worden. Danach gelten, wenn der Insolvenzschuldner eine natürliche Person ist, auch juristische Personen unter anderem dann als nahestehend, wenn der Schuldner oder eine der in Nrn. 1 bis 3 genannten Personen Mitglied des Vertretungsorgans dieser juristischen Person ist. Die bei der Novellierung des Gesetzes unverändert gebliebene Regelung in § 138 Abs. 2 Nr. 3 InsO nehme uneingeschränkt auf die persönlichen Verbindungen nach Absatz 1 Bezug. Damit sei auch die neue Bestimmung des Absatzes 1 Nr. 4 einbezogen. Ist der Insolvenzschuldner eine juristische Person, stehe ihm deshalb eine andere juristische Person nahe, wenn der Geschäftsführer des Insolvenzschuldners zugleich Geschäftsführer des Anfechtungsgegners ist oder wenn zwischen den personenverschiedenen Geschäftsführern ein Näheverhältnis im Sinne von § 138 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 InsO besteht. Entsprechendes habe zu gelten, wenn, wie im Streitfall, die persönliche Verbindung über die Geschäftsführerin der Komplementär-GmbH als der persönlich haftenden Gesellschafterin einer Kommanditgesellschaft hergestellt wird. Es handele sich dabei zumindest um eine vergleichbare gesellschaftsrechtliche Verbindung, die der Beklagten die Möglichkeit gab, sich über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Insolvenzschuldnerin zu unterrichten. Dies begründet nach der letzten Alternative des § 138 Abs. 1 Nr. 4 InsO ebenfalls das Näheverhältnis.
Ob die Anwendung von § 138 Abs. 2 Nr. 3 InsO vorliegend ausgeschlossen war, weil der Geschäftsführer der Insolvenzschuldnerin nach dem zweiten Halbsatz der Norm kraft Gesetzes in den Angelegenheiten der von ihm vertretenen Gesellschaft zur Verschwiegenheit verpflichtet war und die Verschwiegenheitspflicht sich gerade auf die Umstände bezieht, die der Anfechtungsgegner nach der in Rede stehenden Anfechtungsnorm kennen muss, konnte der BGH nach den bisher getroffenen Feststellungen nicht abschließend beurteilen. Geschäftsführer einer GmbH dürften Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis nicht unbefugt offenbaren (§ 85 Abs. 1, § 43 Abs. 1 GmbHG). Zusätzlich sei jedoch zu fordern, dass die Verschwiegenheitspflicht nicht nur generell, sondern auch im konkreten Fall besteht. Nur dann fehle es an der besonderen Informationsmöglichkeit des Anfechtungsgegners, die es rechtfertige, die Anfechtung unter erleichterten Voraussetzungen zu ermöglichen. Konkret könne die Pflicht des Geschäftsführers zur Verschwiegenheit entfallen, wenn das zuständige Organ der Gesellschaft das Geheimhaltungsinteresse aufgibt. Ein solcher Fall sei regelmäßig anzunehmen, wenn der Geschäftsführer zugleich alleiniger Gesellschafter der GmbH ist. Dann sei allein sein Wille dafür maßgeblich, ob eine Tatsache der Geheimhaltung unterliegen soll. Mit der Offenbarung einer Tatsache gebe er konkludent auch ein eventuelles Geheimhaltungsinteresse auf. Feststellungen zu der Frage, ob der Geschäftsführer der Insolvenzschuldnerin auch ihr alleiniger Gesellschafter war, habe das Berufungsgericht aber nicht getroffen.
Fälligkeit des Anspruchs auf Auseinandersetzungsguthaben
BGH, Urteil vom 6. Dezember 2016 – II ZR 140/15
Vorliegend befasste sich der BGH mit der Fälligkeit des Anspruchs auf Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens bei Beendigung einer atypisch stillen Gesellschaft. Der Beklagte war als stiller Gesellschafter an einer AG beteiligt, deren Rechtsnachfolgerin die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, ist. Nachdem die Klägerin ihren Geschäftsbetrieb eingestellt hatte, beschlossen die stillen Gesellschafter, die stille Gesellschaft zum Ende des Jahres 2009 zu „liquidieren“. Per 31. Dezember 2009 wies das Kapitalkonto des Beklagten nach Verrechnung von Gewinngutschrift, Verlustbeteiligungen, Einlage und Ausschüttungen einen Negativsaldo aus, von dem die Klägerin einen Betrag von EUR 10.416,67 gemäß § 16 Nr. 1 d) des Gesellschaftsvertrages mit vorliegender Klage geltend macht. Nach der genannten Regelung des Gesellschaftsvertrages kann die Gesellschaft bei Beendigung der atypisch stillen Gesellschaft vom stillen Gesellschafter ein maximal bis zur Höhe der empfangenen Auszahlungen (Entnahmen/Ausschüttungen) bestehenden negativen Betrag nach Verrechnung mit einem etwaigen Auseinandersetzungsanspruch zurückfordern. Das LG Darmstadt wies die Klage in erster Instanz ab, das OLG Frankfurt am Main hat die dagegen gerichtete Berufung der Klägerin zurückgewiesen.
Der BGH gab der Revision statt und verurteilte den Beklagten zur Zahlung des eingeklagten Betrages. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts folge aus den Regelungen des Gesellschaftsvertrages ein vertraglicher Anspruch der Klägerin gegen die stillen Gesellschafter auf Rückzahlung der erhaltenen Ausschüttungen. Der BGH berief sich insofern auf seine zurückliegende Rechtsprechung im Zusammenhang mit dem vorliegenden Beteiligungsprogramm (z.B. Urteile vom 20. September 2016 ‑ II ZR 120/15, II ZR 139/15). Von dieser Rechtsprechung abzuweichen, bestehe kein Anhaltspunkt.
Darüber hinaus beschäftigte sich der BGH inhaltlich mit einer möglichen Verjährung und der Fälligkeit dieses Anspruchs. Eine Verjährung verneinte der BGH. Die dreijährige Verjährungsfrist nach § 195 BGB habe nicht nach dem Auflösungsbeschluss vom Dezember 2009 am 1. Januar 2010 zu laufen begonnen, da der Anspruch der Klägerin zu diesem Zeitpunkt nicht fällig war. Der Anspruch auf Zahlung eines Auseinandersetzungsguthabens des stillen Gesellschafters entstehe ebenso wie der Verlustausgleichsanspruch mit der Beendigung der stillen Gesellschaft und könne nach seiner Fälligkeit geltend gemacht bzw. mit einer Klage durchgesetzt werden (§ 271 BGB). Da die stille Gesellschaft zum 15. Dezember 2009 beendet worden sei, sei der einem Verlustausgleichsanspruch der Klägerin gleichstehende Anspruch auf Rückerstattung der Ausschüttungen zu diesem Zeitpunkt zwar entstanden, aber nicht auch fällig gewesen. Dies folge aus § 235 Abs. 1 HGB, der verlangt, dass sich der Inhaber des Handelsgeschäfts nach der Auflösung der stillen Gesellschaft mit dem stillen Gesellschafter auseinanderzusetzen hat. Es entspreche der ständigen Rechtsprechung des BGH und der vorherrschenden Ansicht im Schrifttum, dass bei Beendigung einer atypisch stillen Gesellschaft der Anspruch des stillen Gesellschafters auf Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens ebenso wie ein eventueller Verlustausgleichsanspruch des Geschäftsinhabers regelmäßig erst nach der Auseinandersetzung gemäß § 235 Abs. 1 HGB in Form der Durchführung einer Gesamtabrechnung fällig werden, die der Geschäftsinhaber allerdings nicht ungebührlich hinauszögern dürfe. Die danach erforderliche Gesamtabrechnung wurde nach Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2009 im Jahre 2011 erstellt. Anhaltspunkte für ein ungebührliches Verzögern der Gesamtabrechnung jedenfalls über das Jahr 2010 hinaus seien weder ersichtlich noch vorgetragen.
Fortbestehen einer gelöschten ausländischen Gesellschaft
BGH, Beschluss vom 22. November 2016 – II ZB 19/15
Die Beteiligten in diesem betreuungsgerichtlichen Verfahren sind Eigentümer mehrerer Grundstücke, auf denen eine Buchgrundschuld zugunsten der Betroffenen, einer Limited mit Sitz in Nassau/Bahamas, eingetragen ist. Die Beteiligten tragen vor, dass die Betroffene im August 2002 in den Registern der Bahamas wegen nicht beglichener Registergebühren gelöscht worden sei. Die Beteiligten beabsichtigen, die Grundstücke zu veräußern, was aber wegen der noch für die Betroffene eingetragenen Grundschuld, die in Vergessenheit geraten sei, unmöglich sei. Da die Betroffene nach Löschung in den Registern der Bahamas nicht mehr existiere, sei zur Erteilung der Löschungsbewilligung die Anordnung einer Pflegschaft gemäß § 1913 BGB für die Betroffene notwendig. Die Beteiligten haben die Anordnung einer Pflegschaft für die Betroffene angeregt. Das AG Mettmann lehnte die Anordnung ab. Die von den Beteiligten eingelegte Beschwerde verwarf das LG Wuppertal wegen fehlender Beschwerdeberechtigung. Die Rechtsbeschwerde der Beteiligten hatte vor dem BGH nun ebenfalls keinen Erfolg.
Der BGH stellte fest, dass den Beteiligten die Beschwerdeberechtigung nach § 59 Abs. 1 FamFG fehlt. Die Anordnung einer Pflegschaft nach § 1913 BGB scheidet grundsätzlich aus, wenn der rechtliche Träger des Vermögens als solcher bekannt ist und nur seine Organe verhindert oder unbekannt sind. Der rechtliche Träger der auf den Grundstücken lastenden Grundschuld sei in vorliegendem Fall nicht unbekannt in diesem Sinne.
Ein Rechtsträger, der in seinem Heimatstaat infolge staatlicher Zwangseingriffe untergegangen ist, lebe hinsichtlich seines von Zwangsmaßnahmen nicht berührten Vermögens außerhalb seines Heimatstaates weiter, und sei es auch nur zum Zwecke der Liquidation. Das im Ausland belegene Vermögen werde nicht herrenlos, sondern gehöre nach wie vor dem im Interesse der Gesellschafter wie auch der Gläubiger als Restgesellschaft weiterbestehenden Rechtsträger, selbst wenn dieser nach dem Recht seines Heimatstaates erloschen sei. Diese ursprünglich zu Fallgestaltungen staatlicher Enteignungen entwickelten Grundsätze der Rest- und Spaltgesellschaft seien auf im Ausland infolge behördlicher Anordnung gelöschte Gesellschaften übertragbar. Auch hier stünden einer Behandlung als herrenlose oder rechtsträgerlose Vermögensmasse die Interessen der bisherigen Vermögensinhaber, aber auch der potenziellen Gesellschaftsgläubiger entgegen.
Für eine danach bestehende Restgesellschaft könne auch ein Vertretungsorgan bestimmt werden. Die Organe einer Restgesellschaft seien gesellschaftsrechtlich zu bestimmen. Zur Bewältigung von Abwicklungsmaßnahmen bei ursprünglich körperschaftlich strukturierten Gesellschaften sei insofern die Bestellung eines Nachtragsliquidators entsprechend § 273 Abs. 4 S. 1 AktG sachgerecht. Damit ließen sich die Interessen der Beteiligten, der Gesellschaft wie auch potenzieller Gläubiger ausreichend wahren, ohne das Bedürfnis nach einer praktikablen Vorgehensweise zu vernachlässigen. In der vorliegenden Fallgestaltung, wie sie nach dem Vortrag der Beteiligten zu unterstellen sei, diene die Restgesellschaft allein dazu, die rechtliche Klärung über den Fortbestand einer zu ihren Gunsten eingetragenen Grundschuld herbeizuführen. Der Betrieb der Gesellschaft im Übrigen sei bereits langjährig eingestellt und auch organisatorisch habe sie nicht mehr existiert. Seien keine anderweitigen Anhaltspunkte vorhanden, sei für die Bestellung des Nachtragsliquidators dasjenige Amtsgericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk sich das Vermögensrecht befindet.
Anders wäre die Rechtslage zu beurteilen gewesen, wenn auf die Betroffene als werbende Gesellschaft deutsches Recht anwendbar wäre. Bei einer Einordnung der Betroffenen in die gesellschaftsrechtlichen Rechtsformen nach deutschem Recht käme der von den Beteiligten behaupteten Löschung der Betroffenen in den Registern des Staates der Bahamas keine Wirkung für die Rechtsfähigkeit und den Fortbestand zu. Die Vertretung im Rechtsverkehr wäre vielmehr aus der gesellschaftsrechtlichen Einordnung der Betroffenen nach deutschem Recht zu bestimmen. Bei einer Gesellschaft, die wie vorliegend nach dem Vortrag der Beteiligten in einem Drittstaat gegründet worden sein soll, der weder der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört noch aufgrund von Verträgen hinsichtlich der Niederlassungsfreiheit gleichgestellt ist, beurteile sich das Gesellschaftsstatut nach den allgemeinen Regeln des deutschen internationalen Privatrechts, denen zufolge für die Rechtsfähigkeit einer Gesellschaft das Recht des Staates maßgeblich ist, in dem die Gesellschaft ihren tatsächlichen Verwaltungssitz hat. Sollte sich der tatsächliche Verwaltungssitz der Betroffenen zuletzt in Deutschland befunden haben, wären die Rechtsfähigkeit der Betroffenen als in einem Drittstaat gegründeter Gesellschaft und daraus folgend auch ihre Vertretung im Rechtsverkehr nach deutschem Recht zu beurteilen. Der Staat der Bahamas gehört weder zur Europäischen Union bzw. zum Europäischen Wirtschaftsraum noch bestehen völkerrechtliche Verträge, denen zufolge eine nach dem Recht des Staates der Bahamas gegründete Gesellschaft mit Verwaltungssitz in Deutschland gleichwohl nach dem Recht ihres Gründungsstaates zu behandeln wäre. Um als Gesellschaft mit beschränkter Haftung rechtsfähig zu sein, hätte die Betroffene im deutschen Handelsregister eingetragen sein müssen. Je nach Ausgestaltung der gesellschaftlichen Organisationsverhältnisse könne eine in einem Drittstaat gegründete Gesellschaft mit tatsächlichem Verwaltungssitz in Deutschland auch ohne Eintragung im deutschen Handelsregister als rechtsfähige Personengesellschaft, im Fall des Betriebs eines Handelsgewerbes typischerweise als offene Handelsgesellschaft, oder ohne einen solchen als Gesellschaft bürgerlichen Rechts, zu behandeln sein.
Auswirkungen der zeitlichen Begrenzung einer Vollmacht
KG Berlin, Beschluss vom 14. Februar 2017 – 1 W 29-32/17
In dem vom KG Berlin zu entscheidenden Fall verweigerte das Grundbuchamt die Eintragung einer Gesamtbuchgrundschuld, da es der Ansicht war, die vorgelegte (Unter-)Vollmacht zur Bestellung einer Grundschuld sei nur befristet erteilt worden. In der Tat war die zugrunde liegende notarielle (Haupt-)Vollmacht zur Veräußerung eines Grundstücks, die auch die Befugnis zur Erteilung von Untervollmachten und Belastungsvollmachten vorsah, auf einen Zeitraum von zwei Monaten befristet. Innerhalb dieses Zeitraums erteilte der Vollmachtnehmer dem Erwerber des Grundstücks eine Belastungsvollmacht als Untervollmacht, aufgrund der die einzutragende Grundschuld beantragt und bewilligt wurde.
Das KG Berlin gab der Beschwerde gegen die Zwischenverfügung des Grundbuchamts statt. Das von dem Grundbuchamt aufgezeigte Eintragungshindernis bestünde nicht, sodass die Zwischenverfügung nicht veranlasst war. Die Bewilligung der Eintragung einer Grundschuld könne auch durch einen Vertreter erfolgen. Die Vertretungsberechtigung sei dem Grundbuchamt in der Form des § 29 Abs. 1 GBO nachzuweisen. Bei Handlungen eines Unterbevollmächtigten sei die gesamte Vertretungskette nachzuweisen. Vorliegend habe die (Haupt-)Vollmacht ausdrücklich auch das Recht zur Erteilung von Untervollmacht sowie Belastungsvollmacht umfasst. Diese (Haupt-)Vollmacht sei im Zeitpunkt der Beurkundung der Untervollmacht auch (noch) wirksam gewesen. Das sei rechtlich erforderlich, aber auch ausreichend gewesen. Die Wirksamkeit der einmal erteilten Untervollmacht zur unmittelbaren Vertretung des Geschäftsherrn sei grundsätzlich nicht vom weiteren Fortbestand der Hauptvollmacht abhängig. Hieran änderte es vorliegend nichts, dass die (Haupt-)Vollmacht befristet erteilt wurde und im Zeitpunkt der Bewilligung bereits nicht mehr bestand, §§ 163, 158 Abs. 2 BGB. Zwar könne die Untervollmacht nicht weiter gehen als die Hauptvollmacht. Die zeitliche Begrenzung der Hauptvollmacht schließe die Möglichkeit zur Erteilung einer zeitlich unbeschränkten Untervollmacht im Namen des Geschäftsherrn aber grundsätzlich nicht aus. Es komme maßgeblich auf den Willen des Geschäftsherrn bei Erteilung der Hauptvollmacht an. Zwar enthalte die (Haupt-)Vollmacht keine Ausführungen zur Gestattung einer über ihre Befristung hinausgehenden Befugnis zur Erteilung von Untervollmacht. Sie ergebe sich aber durch Auslegung der erteilten Untervollmacht auch bei Berücksichtigung der restriktiven Vorgaben für eine Auslegung im Grundbuchverfahren.
Im Zweifelsfall bedeute die zeitliche Beschränkung einer (Haupt-)Vollmacht, dass der Geschäftsherr nach Fristablauf seine Angelegenheiten wieder selbst wahrnehmen will. Ein solcher Zweifelsfall liege jedoch nicht vor in Angelegenheiten, bei denen sich der Geschäftsherr ohnehin regelmäßig eines Vertreters bedient. So sei es gängige notarielle Praxis, den Erwerber beim finanzierten Grundstückskauf zur Belastung des Grundstücks mit Grundpfandrechten zu bevollmächtigen. Eine entsprechende Finanzierungsvollmacht sei vorliegend im Rahmen der Untervollmacht erteilt worden. Während der Grundstücksverkäufer durchaus ein Interesse daran haben könne, nach Ablauf der befristet erteilten (Haupt-)Vollmacht ein bis dahin ggf. noch nicht zustande gekommenes Hauptgeschäft selbst abzuschließen, sodass insoweit eine darüber hinaus erteilte Untervollmacht ihre Wirkung mit der (Haupt-)Vollmacht verlöre, sei eine solche Interessenlage bei lediglich der Abwicklung des Hauptgeschäfts dienenden Geschäften ersichtlich nicht gegeben. Die dem Grundstückserwerber erteilte Belastungsvollmacht diene wie regelmäßig in erster Linie dazu, die vertraglichen Ziele auch im Interesse des Grundstücksveräußerers zu erreichen und das hierzu erforderliche Verfahren zu vereinfachen.
Stimmverbot eines GmbH-Gesellschafters
OLG Brandenburg, Urteil vom 5. Januar 2017 – 6 U 21/14
In dem zugrunde liegenden Verfahren hatte das Brandenburgische Oberlandesgericht darüber zu entscheiden, inwieweit das Stimmverbot aus § 47 Abs. 4 S. 2 GmbHG analoge Anwendung findet, wenn über ein Rechtsgeschäft mit einer Gesellschaft abgestimmt wird, an der einer der abstimmenden Gesellschafter ein besonderes unternehmerisches Interesse hat.
Die Parteien streiten um die Wirksamkeit eines Beschlusses einer Gesellschafterversammlung der beklagten GmbH. Durch diesen wurde die Geschäftsführung der Beklagten angewiesen, sämtliche Geschäftsanteile an vier Tochtergesellschaften zum Nennwert an eine AG zu verkaufen. Der Kläger ist mit 49 Prozent an der Beklagten beteiligt. Weiterer Gesellschafter zu 51 Prozent ist M. Beide sind zugleich alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Beklagten. Die Beklagte war zu 100 Prozent Eigentümerin von vier Projektgesellschaften polnischen Rechts. Im Juni 2012 beabsichtigte M. als Geschäftsführer der Beklagten, die Anteile an den vier Tochtergesellschaften auf die besagte AG zu übertragen. Die AG ist eine der dem Kläger und M. zuzuordnenden Gesellschaften, die allerdings einem anderen Konzern angehörte als die Beklagte. Alleinaktionärin der AG ist die U-GmbH, deren Geschäftsanteile ebenfalls zu 49 Prozent vom Kläger und zu 51 Prozent von M. gehalten werden. M. ist Vorstandsvorsitzender mit der Befugnis, die Gesellschaft allein zu vertreten und gegen die Beschlüsse der weiteren beiden Vorstandsmitglieder ein Veto einzulegen. Nachdem der Verkauf der polnischen Tochtergesellschaften der Beklagten auf Geschäftsführerebene am Widerspruch des Klägers gescheitert war, berief M. eine Gesellschafterversammlung der Beklagten ein und beantragte, die Geschäftsführung der Beklagten anzuweisen, sämtliche Geschäftsanteile an den vier Tochtergesellschaften zum Nennwert an die AG zu veräußern und ihn zu ermächtigen und zu beauftragen, die entsprechenden Verträge mit der AG im Namen der Beklagten zu verhandeln und abzuschließen. M. stimmte dafür, der Kläger dagegen. M. stellte sodann fest, dass der Beschluss mehrheitlich gefasst worden sei. Gegen diesen Beschluss geht der Kläger vor. Das LG Neuruppin gab der Klage in erster Instanz statt. M. habe in entsprechender Anwendung des § 47 Abs. 4 S. 2 GmbHG einem Stimmverbot unterlegen, weil er als Mehrheitsgesellschafter der U-GmbH der AG, dem Kaufvertragspartner der Beklagten, wirtschaftlich so stark verbunden sei, dass man sein persönliches Interesse an dem Rechtsgeschäft mit dem der AG gleichsetzen könne.
Das OLG Brandenburg gab hingegen der Berufung der Beklagten statt und stellte fest, dass eine Anfechtungsklage gegen den oben genannten Beschluss unbegründet sei: Der fragliche Gesellschafterbeschluss sei mit der nach § 47 Abs. 1 GmbHG erforderlichen einfachen Mehrheit zustande gekommen. Die Stimmen des M. seien zu Recht mitgezählt worden. M. habe zum Zeitpunkt der Abstimmung weder einem Stimmverbot analog § 47 Abs. 4 S. 2 GmbHG unterlegen, noch habe er bei der Zustimmung zum Beschluss gegen eine ihm obliegende gesellschaftsrechtliche Treuepflicht verstoßen.
Eine unmittelbare Anwendung des § 47 Abs. 4 S. 2 GmbHG scheide aus, weil das in Streit stehende Rechtsgeschäft nicht mit M. als Mitgesellschafter, sondern mit der AG geschlossen wurde, an der M. nur mittelbar beteiligt sei. Auch die Voraussetzungen einer analogen Anwendung von § 47 Abs. 4 S. 2 GmbHG seien nicht erfüllt. Denn nicht jedes Rechtsgeschäft einer GmbH mit einer anderen Gesellschaft, an der einer ihrer Gesellschafter ebenfalls beteiligt ist, sei von dem Stimmverbot erfasst. § 47 Abs. 4 GmbHG finde über die ausdrücklich normierten Fälle hinaus nicht auf alle Fälle einer Interessenkollision oder eines Richtens in eigener Sache entsprechende Anwendung. Im Verband würden typischerweise auch Sonderinteressen des Gesellschafters verfolgt und damit entstünden Abgrenzungsschwierigkeiten. Maßgebend für die Annahme eines Stimmverbots sei, ob wegen der Beteiligung des GmbH-Gesellschafters an der Drittgesellschaft deren Befangenheit typischerweise dazu führt, dass von ihrem Gesellschafter in der GmbH ein Vorrang der Eigeninteressen als Gesellschafter der Drittgesellschaft zu erwarten ist. Ein Stimmverbot liege danach nur vor, wenn in der anderweitigen Beteiligung des Gesellschafters ein unternehmerisches Interesse verkörpert ist, das bei Entscheidungen über Rechtsgeschäfte mit dem fremden Unternehmen eine unbefangene Stimmabgabe in der Regel ausschließt und deshalb für die GmbH eine erhebliche Gefahr bedeutet. Nicht maßgeblich sei dabei, ob sich der Interessenkonflikt im Einzelfall tatsächlich nachteilig auswirken würde. Das Stimmverbot gelte, wenn dessen Voraussetzungen vorliegen, also auch bei einem der Gesellschaft vorteilhaften Rechtsgeschäft oder einer berechtigten Entlastung.
Die Mehrheitsbeteiligung des M. an der U-GmbH als Alleinaktionärin der AG führe für sich genommen folglich noch nicht zu einem Stimmverbot in der Gesellschafterversammlung der Beklagten. Denn allein aus einer Beherrschung der Drittgesellschaft durch den GmbH-Gesellschafter lasse sich auf eine Interessenkollision jedenfalls dann nicht schließen, wenn der Gesellschafter, wie hier, zugleich die Mehrheit der Geschäftsanteile in der GmbH besitzt, in deren Gesellschafterversammlung die Abstimmung vorgenommen werden soll. Denn in einem solchen Fall sei nicht gewiss, in welcher Gesellschaft der Gesellschafter seine Interessen mehr verfolgt. Auch ein Abgleich der Beteiligungsquote an beiden Gesellschaften lasse hinreichende Rückschlüsse auf einen Interessenschwerpunkt des M. nicht zu. M. sei sowohl an der Beklagten wie auch an der Alleinaktionärin der AG jeweils in gleichem Umfang von 51 Prozent beteiligt.
Auch aus den personellen Verflechtungen in der Person des M. als Mehrheitsaktionär und einzelvertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied mit Vetorecht gegenüber den Entscheidungen der übrigen Vorstandsmitglieder lasse sich nicht auf ein besonderes unternehmerisches Interesse des M. an der AG schließen, welches dasjenige an der Beklagten in einem Maße übersteigt, dass ein Stimmrechtsverbot begründet sein könnte. Zu einem Stimmverbot führten solche Einflussmöglichkeiten nur dann, wenn sie den Schluss auf ein besonderes unternehmerisches Interesse des M. an der AG zuließen. Dies wäre etwa dann anzunehmen, wenn M. aufgrund der Beherrschung bei der AG eher einen Zugriff auf die Tochtergesellschaften hat, als dies in der Beklagten der Fall gewesen wäre. Davon sei aber nicht auszugehen.
Entgegen der Auffassung des Klägers sei M. auch nicht aus einer gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht dazu verpflichtet gewesen, gegen den Beschluss zu stimmen. Auch wenn eine solche Treupflicht den Gesellschafter einer GmbH grundsätzlich dazu verpflichten könne, in einem bestimmten Sinne abzustimmen und damit die Interessen der Gesellschaft positiv zu fördern, sei dies in jedem Fall nicht bereits dann schon gegeben, wenn die bestimmte Stimmabgabe nur sinnvoll erscheint. Denn ein Gesellschafter sei in der Ausübung seines Stimmrechts grundsätzlich frei. Es bestehe keine Rechtspflicht zur Zustimmung zu Maßnahmen der Geschäftsführung oder zu Maßnahmen, die die Mitgesellschafter für sinnvoll erachten. Die Beurteilung der Zweckmäßigkeit einer Maßnahme sei Aufgabe der Gesellschafter. Sie müssten es grundsätzlich hinnehmen, dass eine Maßnahme beschlossen wird, auch wenn einer von ihnen nach eigener Beurteilung der Dinge nicht zuzustimmen zu können glaubt, oder auch wenn ihnen die zur Beschlussfassung abgegebene Begründung falsch erscheint. Eine Beschränkung der Stimmrechtsausübungsfreiheit komme nur im Ausnahmefall infrage, wenn der Gesellschaftszweck objektiv eine bestimmte Maßnahme zwingend gebiete, also die zu beschließende Maßnahme zur Erhaltung des Geschaffenen oder zur Vermeidung von erheblichen Verlusten dringend geboten und dem Gesellschafter die Zustimmung zumutbar sei. Auch dies konnte vorliegend nicht festgestellt werden.
Beurkundungserfordernis für GmbH-Satzungsänderung
OLG Celle, Beschluss vom 13. Februar 2017 – 9 W 13/17
Die Beschwerdeführerin, eine GmbH, reichte beim Handelsregister die Anmeldung einer Satzungsänderung ein. Das der Anmeldung beigefügte Protokoll der Gesellschafterversammlung war nur vom Notar unterzeichnet. Mit Zwischenverfügung verlangte das Registergericht die Einreichung einer vom Alleingesellschafter der GmbH unterzeichneten Fassung des Gesellschafterbeschlusses. Es gehe nicht nur um die Beurkundung einer sonstigen Tatsache gemäß den §§ 36 ff. BeurkG, sodass die Bestimmungen auf die im Beschwerdeverfahren allein streitgegenständliche Satzungsänderung nicht anwendbar seien.
Die Beschwerde gegen die Zwischenverfügung hatte vor dem OLG Celle Erfolg. Die Beurkundung der Satzungsänderung einer GmbH könne gemäß den §§ 36 ff. BeurkG erfolgen. Bei der Satzungsänderung einer GmbH handele es sich um die formbedürftige Niederschrift über die Beurkundung eines Versammlungsbeschlusses, die als klassischer Anwendungsfall der Beurkundung einer anderen Erklärung als einer Willenserklärung im Sinne des Beurkundungsgesetzes anzusehen sei. Die Beurkundungsform für Willenserklärungen (§§ 6 ff. BeurkG) sei für Gesellschafterbeschlüsse gänzlich ungeeignet. Die Beschlüsse innerhalb von Kapitalgesellschaften würden grundsätzlich durch Abstimmung von einer Mehrzahl von Gesellschaftern gefasst, sodass die vom Einzelnen abgegebene Erklärung regelmäßig nicht gesondert wahrnehmbar werde. Schon deshalb könne grundsätzlich nicht verlangt werden, dass der einzelne Abstimmende den etwa gefassten Beschluss unterzeichnen müsste (so aber § 13 BeurkG). Zudem ließe sich nicht festlegen, ob auch etwa überstimmte Gesellschafter unterzeichnen müssten bzw. eine Willenserklärung welchen Inhalts sie unterzeichnen sollten. Im Streitfall von diesen Grundsätzen abzuweichen, weil es sich bei der Gesellschaft um eine sogenannte Einmanngesellschaft handelt, bestehe kein Anlass. Soweit § 48 Abs. 3 GmbHG für Beschlüsse des Alleingesellschafters verlange, dass er über die Beschlussfassung eine Niederschrift aufzunehmen und diese zu unterschreiben habe, rechtfertige dies die vom Registergericht geforderte seitens des Gesellschafters unterschriebene Fassung des Beschlusses ebenfalls nicht. Zum einen sei für § 48 Abs. 3 GmbHG anerkannt, dass ein Verstoß gegen die Protokollierungspflicht die Wirksamkeit des Beschlusses nicht hindert. Zum anderen sei anerkannt, dass anderweitig manipulationsresistent festgehaltene Beschlüsse, mithin auch der Satzungsänderungsbeschluss des Streitfalles, der Protokollierungspflicht nicht unterliegen, weil in diesen Fällen die Ratio des § 48 Abs. 3 GmbHG nicht berührt werde.
„Herausformwechsel“ einer GmbH in italienische S.r.l.
OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 3. Januar 2017 – 20 W 88/15
Die Beschwerdeführerin ist im Handelsregister des AG Frankfurt am Main als GmbH eingetragen. Mit der hier streitigen Handelsregisteranmeldung meldete der Geschäftsführer eine Sitzverlegung nach Rom an und, dass die Gesellschafter als italienische Rechtsform die „Societa a responsibilità limitata“ wählen und der Antrag an das Handelsregister Rom bei einer unverzüglich abzuhaltenden Gesellschafterversammlung gestellt werde. Ein dem Wortlaut der Handelsregisteranmeldung entsprechender notariell beurkundeter Gesellschafterbeschluss über die vorstehende Satzungsänderung fügte der Geschäftsführer der Handelsregisteranmeldung bei. Das Registergericht lehnte die Eintragung mit der Begründung ab, dass der Satzungssitz ein Ort innerhalb Deutschlands sein müsse. Eine grenzüberschreitende Sitzverlegung sei derzeit noch nicht möglich. Die Gesellschafter beschlossen in Italien in notarieller Form eine Satzung nach italienischem Recht. Anschließend wurde die Beschwerdeführerin im Handelsregister in Italien als S.r.l. eingetragen. Das Registergericht wies dennoch die beantragte Eintragung zurück.
Das OLG Frankfurt am Main kam in seiner Beschwerdeentscheidung zu dem Ergebnis, dass die vom Registergericht angeführten Gründe die Zurückweisung der Handelsregisteranmeldung nicht tragen. Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH führe eine unionsrechtskonforme Rechtsanwendung dazu, dass auch der vorliegende „Herausformwechsel“ nach Italien wegen des durch Artikel 49 und 54 AEUV auch für eine Kapitalgesellschaft abgesicherten Rechts auf freie Niederlassung dem Grunde nach zulässig ist.
Das OLG Frankfurt am Main gab der Beschwerdeführerin zunächst damit Recht, dass die vorliegende Handelsregisteranmeldung nicht lediglich eine grenzüberschreitende Sitzverlegung beinhalte, sondern zugleich ein Rechtsformwechsel von einer deutschen GmbH in eine italienische Societa a responsibilità limitata (S.r.l.) angemeldet werden sollte. Dies ergebe die Auslegung der Handelsregisteranmeldung, die lediglich Grundlage der vom Registergericht vorzunehmenden Eintragung im Handelsregister sei. Eine Handelsregisteranmeldung müsse zwar die einzutragende Tatsache eindeutig und vollständig bezeichnen, aber nicht zwingend einen bestimmten Wortlaut haben. In der vorgelegten Anmeldung sei neben der angemeldeten Sitzverlegung nach Rom ausdrücklich die Wahl einer „società a responsabilità limitata“ als italienische Rechtsform durch die Gesellschafter enthalten gewesen. Daraus sei ohne Weiteres deutlich geworden, dass für die Beschwerdeführerin nicht lediglich eine rechtsformwahrende Sitzverlegung nach Italien angemeldet werden sollte, sondern vielmehr ein mit der Sitzverlegung verbundener Rechtsformwechsel.
Da der entsprechende Gesellschafterbeschluss inhaltlich der Anmeldung entspreche, beinhaltete der Gesellschafterbeschluss nach Ansicht des OLG Frankfurt am Main neben der Sitzverlegung auch den Formwechsel. Darauf, dass bei der Beschlussfassung tatsächlich keine ausdrückliche Bezugnahme auf das Umwandlungsgesetz erfolgt ist, komme es im Rahmen der Auslegung des Beschlusses nicht an.
Anschließend legte das OLG Frankfurt am Main ausführlich dar, dass auch der vorliegende „Wegzugsfall“ bzw. „Herausformwechsel“ einer deutschen GmbH nach Italien trotz der Regelungen in § 1 Abs. 1 Nr. 4 UmwG bzw. § 191 Abs. 2 UmwG grundsätzlich möglich ist. Die dortigen Regelungen, wonach Rechtsträger mit Sitz im „Inland“ durch Formwechsel umgewandelt werden können bzw. der auf deutsche Rechtsträger bezogene Kanon der Rechtsträger, die nur Rechtsträger neuer Rechtsform sein können, seien unter Beachtung der Rechtsprechung des EuGH unionsrechtskonform im Sinne einer derartigen Möglichkeit auszulegen. Das OLG beruft sich insofern auf die Urteile des EuGH zu SEVIC (Urteil vom 13. Dezember 2005 ‑ C-411/03), VALE (Urteil vom 12. Juli 2012 ‑ C-378/10) und zu CARTESIO (Urteil vom 16. Dezember 2008 ‑ C-210/06).
Der Anerkennung der Zulässigkeit eines „Herausformwechsels“ steht aus Sicht des OLG Frankfurt am Main auch nicht entgegen, dass es sich bei dem vorliegenden „Herausformwechsel“ einer deutschen GmbH in eine italienische S.r.l. nicht um einen Formwechsel im Sinne des deutschen Umwandlungsrechts handelt. Dort sei ein Formwechsel einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine andere Gesellschaft mit beschränkter Haftung nicht vorgesehen. Wenn schon ein „rechtsforminkongruenter Herausformwechsel“ dem Grund nach zulässig ist, könne für einen „rechtsformkongruenten Herausformwechsel“ a maiore ad minus nichts anders gelten, zumal der EuGH ja gerade einen derartigen Fall eines „rechtsformkongruenten“ Formwechsels einer italienischen S.r.l. in eine ungarische Kft, also in die ungarische Parallelform zur GmbH, in seinem Urteil zu VALE entschieden habe.
Damit die auch für den vorliegenden „Herausformwechsel“ geltende Niederlassungsfreiheit innerhalb der EU letztlich nicht mangels Vorhandenseins entsprechender Verfahrensvorschriften faktisch ins Leere läuft, hält das OLG Frankfurt am Main ‑ soweit das deutsche Registergericht durch das Verfahren des „Herausformwechsels“ betroffen ist ‑ einen Rückgriff auf die Regelungen des UmwG in den §§ 190 ff UmwG für zulässig, wobei im Einzelfall eine europarechtskonforme entsprechende Anwendung geboten sei. Hierbei sei auch die zwischenzeitlich erfolgte Eintragung der Beschwerdeführerin im Handelsregister in Rom zu beachten. Bei einer europarechtskonformen Auslegung der entsprechenden deutschen Bestimmungen des Umwandlungsgesetzes seien für das deutsche Registerverfahren auch die hier maßgeblichen in § 202 Abs. 1 Nr. 1 und 3, Abs. 2 und Abs. 3 UmwG normierten Regelungen zu den Wirkungen einer Eintragung des Formwechsels im Handelsregister entsprechend anzuwenden. Wenn man, wie bislang wohl das Registergericht, von einer Eintragung der Beschwerdeführerin im Handelsregister in Rom ausgeht, würde eine Nichtanwendung dieser Regelungen dazu führen, dass die dort normierten Rechtsfolgen nur deswegen nicht zum Tragen kämen, weil es sich nicht um ein Handelsregister eines deutschen Registergerichts handelt. Eine derartige selektive Anwendung der deutschen Regelungen zum Umwandlungsrecht, die unterschiedliche Rechtsfolgen an die Eintragung im neuen Register knüpfen würde, je nachdem, ob es sich um den Fall eines innerstaatlichen Formwechsels handelt oder aber um einen gleichartigen Fall eines innerhalb der EU erfolgenden „Herausformwechsels“, würde im Ergebnis zu einer Benachteiligung der Beschwerdeführerin führen, die mit dem Äquivalenzgrundsatz nicht vereinbar wäre. Besondere Gründe, die eine unterschiedliche Behandlung des „Herausformwechsels“ gegenüber dem innerstaatlichen Rechtsformwechsel zwingend erforderlich machen würden, sieht das OLG Frankfurt am Main nicht.
Somit werde das Registergericht im vorliegenden Fall, jedenfalls soweit es bei seiner bisher nicht infrage gestellten Annahme einer Eintragung der Beschwerdeführerin im Handelsregister in Rom bleibt, für sein weiteres Verfahren davon auszugehen haben, dass die Beschwerdeführerin mit der erfolgten Eintragung der neuen Rechtsform als S.r.l. italienischen Rechts weiterbesteht (entsprechend § 202 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 UmwG). Weiterhin werde das Registergericht ausgehend von der Annahme der Eintragung im Handelsregister in Rom davon auszugehen haben, dass auch der Umstand eines fehlenden Umwandlungsberichts die Wirkungen der Eintragung im neuen Register unberührt lässt (entsprechend § 202 Abs. 3 bzw. § 202 Abs. 1 Nr. 3 UmwG). Gleiches gelte auch für den bislang nicht sämtliche in § 194 Abs. 1 UmwG aufgestellten Anforderungen erfüllenden Umwandlungsbeschluss und für die Frage, ob der Formwechsel ‑ trotz der Beurkundung durch eine italienische Notarin und als entsprechende Bestätigung des Beschlusses ‑ das Formerfordernis einer notariellen Beurkundung erfüllen würde (§ 193 Abs. 3 S. 1 UmwG).
Wirkung der im Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste
OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 4. November 2016 – 20 W 269/16
Dem vorliegenden Beschwerdeverfahren liegt folgender stark verkürzter Sachverhalt zugrunde: Die Beschwerdeführerin, eine GmbH, wendet sich gegen einen Beschluss des Registergerichts zur Abweisung ihres „Antrags“ vom September 2016 auf Löschung des Beteiligten zu 2 als Geschäftsführer der Beschwerdeführerin. Die letzte zum Handelsregister aufgenommene Gesellschafterliste der Beschwerdeführerin weist alleine die D GmbH als Gesellschafterin der Beschwerdeführerin aus. Grundlage dieser Gesellschafterliste war ein Beschluss der Gesellschafterversammlung der Beschwerdeführerin über die Zwangsabtretung der Geschäftsanteile der bisherigen beiden weiteren Gesellschafter auf die D GmbH, dessen Wirksamkeit zwischen den Beteiligten jedoch streitig ist. In der Folge wurde der Gesellschafterliste ein Widerspruch hinsichtlich der Zwangsabtretungen zugeordnet. Danach hatte der Beteiligte zu 2 im Frühjahr 2016 seine Bestellung zum Geschäftsführer unter Bezug auf einen Gesellschafterbeschluss angemeldet, der darauf verwies, dass einer der beiden weiteren Gesellschafter, die B GmbH, (Anm.: die vorstehende Zwangsabtretung ignorierend) an der Beschwerdeführerin beteiligt sei und diesem gemäß der Satzung der Beschwerdeführerin das Sonderrecht zustehe, den Beteiligten zu 2 als Geschäftsführer der Beschwerdeführerin zu bestellen. Das Registergericht trug daraufhin den Beteiligten zu 2 als Geschäftsführer der Beschwerdeführerin ein.
Die D GmbH fasste daraufhin einen Gesellschafterbeschluss zur Abberufung des Beteiligten zu 2 als Geschäftsführer der Beschwerdeführerin. Die Abberufung wurde ordnungsgemäß zum Handelsregister angemeldet. Über diese Anmeldung ist bislang durch das Registergericht noch nicht entschieden. Auf einen Schriftsatz der Beschwerdeführerin, in dem darauf hingewiesen wurde, dass der Beteiligte zu 2 ohne Gesellschafterbeschluss und ohne Zustimmung der „alleinigen“ Gesellschafterin B GmbH zum Geschäftsführer bestellt worden sei, wies das Registergericht eine Löschung der Geschäftsführereintragung gemäß § 395 FamFG zurück und half auch der hiergegen gerichteten Beschwerde der Beschwerdeführerin nicht ab.
Das OLG Frankfurt am Main kam zu dem Ergebnis, dass die Begründung des Registergerichts für die Nichteinleitung des Amtslöschungsverfahrens nach § 395 FamFG dessen Entscheidung nicht trägt. Das Registergericht stelle bei seiner Verneinung des Vorliegens einer unzulässigen Eintragung im Sinne von § 395 Abs. 1 FamFG tragend darauf ab, dass die B GmbH zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Bestellung des Beteiligten zu 2 zum Geschäftsführer der Beschwerdeführerin Gesellschafterin der Beschwerdeführerin gewesen sei. Diese Rechtsansicht berücksichtige nicht in ausreichendem Maß die Bedeutung und Tragweite von § 16 Abs. 1 S. 1 GmbHG. Nach § 16 Abs. 1 S. 1 GmbHG gelte im Verhältnis zur Gesellschaft im Fall einer Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung als Inhaber eines Geschäftsanteils nur, wer als solcher in der im Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste (§ 40 GmbHG) eingetragen ist. Vorliegend sei dies zum Zeitpunkt des hier maßgeblichen, der Eintragung des Beteiligten zu 2 als Geschäftsführer zugrunde liegenden Beschlusses ausschließlich die D GmbH gewesen. § 16 Abs. 1 S. 1 GmbHG begründe unabhängig von der materiellen Rechtslage, also auch im Falle einer unwirksamen Anteilsübertragung, eine relative oder formale Rechtsstellung des Gesellschafters durch Normierung einer gesetzlichen Fiktion oder nach anderer Auffassung einer unwiderleglichen Vermutung. Daraus folge der Grundsatz, dass die GmbH nur den in der Gesellschafterliste Eingetragenen als Gesellschafter behandeln darf, und zwar unabhängig von der materiellen Rechtslage. An diese Wirkung, die alle mitgliedschaftlichen Rechte und Pflichten erfasse, sei auch das Registergericht gebunden. Lediglich in besonderen ‑ hier nicht vorliegenden ‑ Ausnahmesituationen solle die Legitimationswirkung des § 16 Abs. 1 S. 1 GmbHG nicht eintreten. Wertende Betrachtungsweisen im Sinne einer „teleologischen Reduktion“ dürften nicht dazu führen, dass streitige Umstände im Anwendungsbereich von § 16 Abs. 1 GmbHG zu einer Entscheidung dieser materiell rechtlichen Fragen führen, und zwar aus Gründen der Rechtssicherheit und des Verkehrsschutzes. Auch im vorliegenden Sachzusammenhang gehe es letztlich um die zwischen den Beteiligten streitige Frage, ob die durchgeführte Zwangsabtretung materiell rechtlich wirksam ist, deren Entscheidung im Rahmen des § 16 Abs. 1 S. 1 GmbHG aus Gründen der Rechtsicherheit und des Verkehrsschutzes gerade nicht erfolgen solle. Es sei für die Anwendung des § 16 Abs. 1 S. 1 GmbHG auch unerheblich, dass der Gesellschafterliste ein Widerspruch zugeordnet sei. Ein solcher zerstöre nur die Gutglaubenswirkung des § 16 Abs. 3 GmbHG, nicht jedoch die relative Gesellschafterstellung nach § 16 Abs. 1 GmbHG.
Die Entscheidung des Registergerichts, ein Amtslöschungsverfahren nach § 395 FamFG nicht einzuleiten, war aus Sicht des OLG Frankfurt am Main aber jedenfalls derzeit im Ergebnis richtig. Nach Auffassung des OLG Frankfurt am Main liegt eine entscheidungsreife Anmeldung der Abberufung des Beteiligten zu 2 als Geschäftsführer der Beschwerdeführerin vor. Deshalb bedarf es keiner Amtslöschung nach § 395 Abs. 1 FamFG und des damit verbundenen, auch zeitaufwendigen förmlichen Verfahrens nach § 395 Abs. 2 und 3 FamFG i.V.m. § 393 Abs. 3 bis 5 FamFG. Die sachliche Berichtigung des Registerblatts der Beschwerdeführerin im Hinblick auf die dortige Eintragung des Beteiligten zu 2 als Geschäftsführer der Beschwerdeführerin könne auf einfacherem Weg erfolgen. In dieser besonderen Verfahrenskonstellation komme somit jedenfalls derzeit die in das Ermessen des Registergerichts gestellte Durchführung eines Amtslöschungsverfahrens nicht infrage. Die Beschwerde war daher aus diesem Grund zurückzuweisen.
„Sanieren oder Ausscheiden“ in einer (Publikums-)GmbH & Co. KG
OLG Karlsruhe, Urteil vom 22. April 2016 – 4 U 226/15
In der Vergangenheit hatte der BGH in seinen „Sanieren oder Ausscheiden“-Urteilen für die GbR (BGH, Urteil vom 9. Juni 2015 ‑ II ZR 420/13) und die OHG (Urteil vom 19. Oktober 2009 ‑ II ZR 240/08) entschieden, dass ein Gesellschafter, der seine Teilnahme an den Sanierungsbemühungen der Gesellschaft verweigert, sich als Ausfluss seiner gesellschafterlichen Treuepflicht so behandeln lassen muss, als hätte er damit seinem Ausschluss zugestimmt, auch wenn der Gesellschaftsvertrag hierzu keine ausdrückliche Regelung enthält. Das OLG Karlsruhe hat nun in vorliegender Entscheidung diese Grundsätze auch auf eine GmbH & Co. KG übertragen.
Der Beklagte war Kommanditist eines in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG gegründeten Publikums-Immobilienfonds. Die eingetragene Hafteinlage des Beklagten war ‑ wie bei den übrigen Kommanditisten ‑ doppelt so hoch wie seine Pflichteinlage. Zur Abwendung der Liquidation und zur Erreichung einer Sanierung beschlossen die meisten Gesellschafter, dass die Kommanditisten einen Sanierungsbeitrag in Höhe der Differenz zwischen ihrer Pflicht- und der eingetragenen Hafteinlage leisten sollten. Gleichzeitig beschlossen die Gesellschafter den Ausschluss derjenigen Gesellschafter, die den Sanierungsbeitrag nicht bis zu einem festgesetzten Zeitpunkt geleistet hatten. Der Beklagte weigerte sich den Sanierungsbeitrag zu leisten. Er wurde daraufhin aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Nach Erstellung einer Auseinandersetzungsbilanz macht die klagende GmbH & Co. KG die bislang nicht geleistete Differenz zwischen der Pflicht- und der eingetragenen Hafteinlage gegenüber dem Beklagten geltend.
Nachdem das LG Offenburg in erster Instanz die Klage abgewiesen hatte, gab das OLG Karlsruhe der Klägerin nun in der Berufung Recht. Der Ausschluss des Beklagten aus der Klägerin sei wirksam. Für die OHG und die GbR habe der BGH bereits entschieden, dass ein Gesellschafter, der seine Teilnahme an den Sanierungsbemühungen der Gesellschaft verweigert, treuepflichtwidrig handelt, wenn er gleichwohl in der Gesellschaft bleiben will. Er müsse sich als Ausfluss seiner gesellschafterlichen Treuepflicht so behandeln lassen, als hätte er damit seinem Ausschluss zugestimmt, auch wenn der Gesellschaftsvertrag hierzu keine ausdrückliche Regelung enthält. Diese Grundsätze seien auf die Kommanditgesellschaft uneingeschränkt übertragbar, solange eine Kommanditgesellschaft, wie hier, von ihren Kommanditisten im Sanierungsfall einen freiwilligen Beitrag verlangt, der zusammen mit der geleisteten Pflichteinlage auf die Höhe der eingetragenen Haftsumme begrenzt ist.
Die Mitgesellschafter hätten vorliegend darauf vertrauen dürfen, dass sie den Beklagten ohne seine Zustimmung ausschließen können. Für die berechtigte Erwartungshaltung der Mitgesellschafter spreche schon, dass der Gesellschaftsvertrag den Eintrag einer Haftsumme in Höhe des Doppelten der Pflichteinlage des jeweiligen Kommanditisten vorsieht. Damit sei allen Kommanditisten klar gewesen, dass ihnen die Inanspruchnahme bis zur Höhe der Haftsumme im Falle der Liquidation drohte. Im Falle einer notwendigen Sanierung würden sie vor die Wahl gestellt, entweder sich durch einen Beitrag bis zur Höhe der Haftsumme gegenüber der Klägerin an den Sanierungsbemühungen zu beteiligen, oder bei Ablehnung derselben Zahlungen bis zur Höhe der Haftsumme an die Gläubiger oder den Insolvenzverwalter zu erbringen. Damit werde den Kommanditisten nicht entgegen § 161 Abs. 2, § 105 Abs. 3 HGB, § 707 BGB eine Erhöhung ihrer Beitragspflicht, praktisch eine faktische Nachschusspflicht, gegen ihren Willen abverlangt.
Eine Nichtzulassungsbeschwerde ist derzeit beim BGH unter dem Aktenzeichen II ZR 112/16 anhängig.
Wirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses über Vorstandsbestellung
OLG München, Endurteil vom 12. Januar 2017 – 23 U 3582/16
Die Parteien streiten um die Wirksamkeit von zwei Aufsichtsratsbeschlüssen der beklagten AG. Der Kläger ist Mitglied des aus sechs Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrats der Beklagten. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden nach den Regelungen der Satzung mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung wurden zwei Beschlüsse gefasst, einer betraf die Bestellung eines Vorstandsmitglieds und ein anderer den Abschluss eines Beratervertrages mit einer Gesellschaft, die zu 46,2 Prozent an der Beklagten beteiligt war. Es stimmten jeweils drei Aufsichtsratsmitglieder, einschließlich des Vorsitzenden, für die Beschlussanträge, drei Aufsichtsratsmitglieder, u. a. der Kläger, dagegen. Ein Protokoll der Aufsichtsratssitzung wurde nicht angefertigt. Der Kläger hält die Beschlüsse für nichtig, da ihm keine ausreichenden Informationen über die Qualifikationen des Vorstandskandidaten und den Inhalt des Beratervertrags mit dem Gesellschafter zur Verfügung gestellt worden seien.
Nachdem das LG München II in erster Instanz die Beschlüsse für nichtig gehalten hatte, stellte das OLG München dies im Rahmen der hier vorliegenden Berufung lediglich für den Beschluss hinsichtlich des Abschlusses des Beratervertrages fest. Der Beschluss zur Vorstandsbestellung ist aus Sicht des OLG München wirksam. Eine Nichtigkeit der Beschlüsse wegen Anwesenheit des Sohnes des Aufsichtsratsvorsitzenden, der auch Vorstandsmitglied der Beklagten war, lehnte das OLG München ab. Nach § 109 Abs. 1 S. 2 AktG könne der Aufsichtsrat Sachverständige und Auskunftspersonen zur Beratung über einzelne Gegenstände zuziehen. § 109 Abs. 3 AktG erlaube unter gewissen Voraussetzungen die Teilnahme Dritter an Aufsichtsratssitzungen sogar anstelle von Aufsichtsratsmitgliedern. In allen diesen Fällen könne ein Aufsichtsratsbeschluss durch Dritte beeinflusst werden. Ein Aufsichtsratsbeschluss sei daher nicht schon deshalb unwirksam, weil eine dritte Person an der Sitzung teilgenommen und den Beschluss möglicherweise beeinflusst hat. Auch die Tatsache, dass über die Aufsichtsratssitzung keine Niederschrift angefertigt wurde, verstoße zwar gegen § 107 Abs. 2 S. 1, 2 AktG, führe allerdings nach § 107 Abs. 2 S. 3 AktG nicht zur Unwirksamkeit des Beschlusses.
Bei dem Beschluss zur Vorstandsbestellung habe der Aufsichtsrat mit der Auswahl des neuen Vorstandsmitglieds auch nicht gegen zwingendes Gesetzes- oder Satzungsrecht verstoßen oder seinen Ermessenspielraum überschritten. Das Gesetz stelle Anforderungen an einen Vorstand nur in § 76 Abs. 3 AktG auf. Von den Ausschlussgründen des § 76 Abs. 3 S. 2 AktG liege unstreitig keiner vor. Der Aufsichtsrat habe darauf zu achten, dass die Vorstandsmitglieder in persönlicher und fachlicher Hinsicht die nötigen Qualifikationen für ihr Amt erfüllen. Dabei habe der Aufsichtsrat bei der Entscheidung über die Bestellung eines Vorstands aber ein breites, eigenes unternehmerisches Ermessen. Er habe das Recht zur selbstständigen Auswahl der Vorstandsmitglieder und sei dabei keinerlei Weisungen, verbindlichen Vorschlagsrechten oder Zustimmungsvorbehalten unterworfen, sondern berechtigt und verpflichtet, eigenständig zu entscheiden. Eine Ermessensüberschreitung oder eine Zurückhaltung maßgeblicher Informationen über das zu wählende Vorstandsmitglied konnte das OLG München vorliegend nicht erkennen. Auch die Bestellung des neuen Vorstandsmitglieds für nur acht Monate mache die Bestellung nicht unwirksam. § 84 Abs. 1 S. 1 AktG sehe zwar eine Höchstdauer für die Bestellung von fünf Jahren, aber keine Mindestdauer vor. Der Aufsichtsrat könne bei einer übermäßig kurzen Bestellung zwar pflichtwidrig handeln, jedoch bleibt die Bestellung dennoch wirksam.
Den Beschluss über den Beratervertrag zwischen der Beklagten und dem Gesellschafter hält das OLG München jedoch für nichtig: Entgegen der Ansicht der Beklagten sei der Abschluss des Beratervertrags keine Maßnahme der Geschäftsführung, für die eine Zustimmung des Aufsichtsrat nicht nötig wäre. Vielmehr sei vorliegend nicht nur die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich, sondern der Aufsichtsrat sogar für den Abschluss des Beratervertrags selbst zuständig: Die Entscheidung über die Vergütung der Vorstandsmitglieder und der Abschluss der die Vergütung betreffenden Verträge fallen nach § 84 Abs. 1 S. 5 i. V. m. S. 1, § 87, § 112 AktG in die Zuständigkeit des Aufsichtsrats. Der Abschluss dieser Verträge gehöre auch dann zur Kompetenz des Aufsichtsrats, wenn sie von der Gesellschaft nicht mit dem Vorstandsmitglied selbst, sondern einem Dritten abgeschlossen werden und mit diesem eine Vergütung für die Vorstandstätigkeit vereinbart wird. Nur dadurch sei der Gleichlauf von Bestellungs- und Anstellungskompetenz gewährleistet. Ob der Vertrag als Beratervertrag und die zu erbringenden Leistungen als Beraterleistungen bezeichnet werden, sei ohne Belang. Maßgeblich sei lediglich der Inhalt der Vereinbarung. Wenn durch den „Beratervertrag“ auch Leistungen abgegolten werden sollen, die von anderen Mitarbeitern erbracht werden, die selbst nicht zum Vorstand bestellt wurden, schließe dies die Zuständigkeit des Aufsichtsrats ebenfalls nicht aus. Vorliegend habe der Beklagte selbst vorgetragen, dass der Beratervertrag zumindest auch die Vorstandsvergütung eines Vorstandsmitgliedes abdecken solle, sodass von einer Zuständigkeit des Aufsichtsrats auszugehen gewesen sei. Der Aufsichtsrat sei nach § 87 Abs. 1 S. 1 AktG verpflichtet, bei der Festsetzung der Gesamtbezüge des einzelnen Vorstandsmitglieds dafür zu sorgen, dass diese in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds stehen und die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigen. Gegen diese Anforderungen verstößt der Beschluss nach Auffassung des OLG München dadurch, dass aus den vorgelegten Unterlagen nicht ersichtlich war, wie hoch die konkrete Vergütung für die im Beratervertrag abgedeckte Vorstandsvergütung war und ob die geplante Vorstandsvergütung in einem angemessenen Verhältnis zu ihren Aufgaben und Leistungen steht.
Ergänzung der Tagesordnung durch Hauptaktionär
LG Frankfurt am Main, Urteil vom 27. Oktober 2016 – 3-05 O 157/16
Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft, deren Aktien im Freiverkehr gehandelt werden. Die Klägerinnen sind Aktionäre der Beklagten. Die Beklagte lud zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung für den 31. Mai 2016 ein. Der Nachweisstichtag war in der Einladung auf den 10. Mai 2016, 00:00 Uhr, festgesetzt. Am 12. Mai 2016 veröffentlichte die Beklagte ein Verlangen einer Aktionärin, die über 50 Prozent der Anteile an der Beklagten hält, gemäß den §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG über die Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung hinsichtlich der hier streitgegenständlichen Beschlussfassung einer Kapitalerhöhung. In der Hauptversammlung wurde mit einer Mehrheit von 85,27 Prozent der vorgeschlagene Beschluss gefasst. Die Kläger halten die Beschlussfassung für anfechtbar oder nichtig, da die Tagesordnungsergänzung nicht in der gesetzlichen Frist bei der Gesellschaft eingegangen sei. Jedenfalls sei das Ergänzungsverlangen verspätet bekannt gegeben worden. Zudem handle sich bei dem Ergänzungsverlangen nach § 122 Abs. 2 AktG um ein Recht der Minderheit, das der Hauptaktionärin nicht zugestanden habe.
Das LG Frankfurt am Main hielt die Klage für begründet. Der fragliche Kapitalerhöhungsbeschluss sei für nichtig zu erklären, da über ihn mangels ordnungsgemäßer Bekanntmachung nach § 124 Abs. 4 AktG kein Beschluss hätte gefasst werden dürfen. Das LG Frankfurt am Main stellte zunächst klar, dass auch ein Hauptaktionär einen Antrag nach § 122 Abs. 2 AktG auf Ergänzung der Tagesordnung stellen kann. Zwar nenne § 122 AktG in seiner Überschrift „Minderheitsverlangen“, doch enthalte der weitere gesetzliche Wortlaut dieser Bestimmung keine Beschränkungen dahin, dass die dort normierten Rechte nur von Aktionärsminderheiten wahrgenommen werden könnten. Die Vorschrift des § 122 AktG regele vielmehr nur die Grenze nach unten, d.h. welcher Anteilsbesitz mindestens erreicht sein muss, um die dort geregelten Rechte wahrzunehmen. Dies ergebe sich auch aus Artikel 6 Abs. 1 der europäischen Aktionärsrechterichtlinie (Richtlinie 2007/36/EG), in der nicht zwischen Minder- und Mehrheitsaktionären unterschieden wird und dessen Umsetzung durch § 122 Abs. 2 AktG erfolgen sollte.
Da die Beklagte jedoch nicht börsennotiert im Sinne der Legaldefinition des § 3 Abs. 2 AktG sei, müsse das Ergänzungsverlangen gemäß § 124 Abs. 2 S. 3 AktG nur 24 Tage vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingehen, was durch den ‑ bestrittenen ‑ Eingang am 6. Mai 2016 für die am 31. Mai 2016 stattgefundene Hauptversammlung gewährt gewesen wäre. Die Bekanntmachung dieses Ergänzungsverlangen am 12. Mai 2016 im Bundesanzeiger sei aber nicht mehr rechtzeitig gewesen. Die Aktionäre sollen möglichst frühzeitig über die geänderte Tagesordnung informiert werden, sodass sie auf die Änderungen gegebenenfalls noch durch eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. Abstimmung per Briefwahl oder Benennung eines Vertreters reagieren können und die Aktionäre noch vor dem sogenannten Stichtag des Nachweises des Aktienbesitzes (record date) ihren Stimmenanteil ggf. in Reaktion auf das Ergänzungsverlangen aufstocken können. Die Bekanntmachung des Ergänzungsverlangens dürfe daher nicht nach dem Tag des Nachweises des Aktienbesitzes (hier 10. Mai 2016, 00:00 Uhr) liegen.