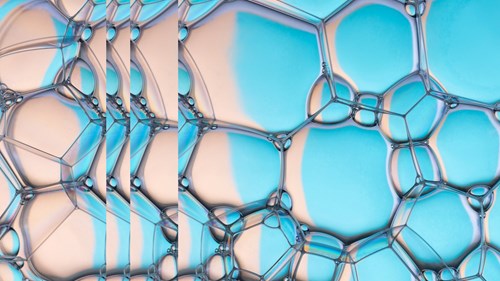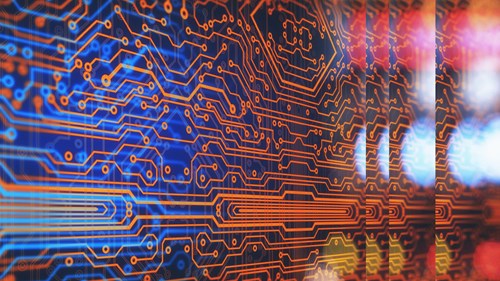Die wichtigsten BGH-Entscheidungen im Gesellschaftsrecht 2021
Zu Beginn des Jahres 2022 blicken wir zurück auf die für die gesellschafts- und transaktionsrechtliche Beratung wichtigen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs („BGH“) im vergangenen Jahr. Folgende Entscheidungen sind aus unserer Sicht hervorzuheben:
- Anfechtungsbefugnis eines nicht mehr in der Gesellschafterliste eingetragenen Gesellschafters
- Verjährungsbeginn des Abfindungsanspruchs bei strittigem Ausschluss eines Gesellschafters
- Anwendungsbereich der Zustimmungspflicht für Beratungsverträge zwischen der AG und ihrem Aufsichtsrat
- Ausschüttung von Gewinnvorträgen als anfechtbare Rechtshandlung
- Festsetzung einer Geldbuße gegen den Rechtsnachfolger
- Annahme des Übernahmeangebots ist Voraussetzung für den Anspruch auf angemessene Gegenleistung
Anfechtungsbefugnis eines nicht mehr in der Gesellschafterliste eingetragenen Gesellschafters
(Urteil vom 26.01.2021 – II ZR 391/18)
Sachverhalt: Nachdem es zum Zerwürfnis eines Gründungsgesellschafters und Geschäftsführers mit seinen beiden Mitgesellschaftern gekommen war, beschloss die Gesellschafterversammlung die Einziehung seines Geschäftsanteils, seine Abberufung als Geschäftsführer, die fristlose Kündigung seines Geschäftsführeranstellungsvertrags sowie die Ermächtigung zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen diesen. Er klagte daraufhin gegen die GmbH als Beklagte. In der kurz darauf im Handelsregisterordner der GmbH aufgenommenen Gesellschafterliste war der Kläger nicht mehr als Gesellschafter eingetragen. Im Folgenden fanden weitere Gesellschafterversammlungen zur Wiederholung bzw. Bestätigung dieser bereits gefassten Beschlüsse statt. Der Kläger hatte gegen die Beschlüsse Nichtigkeitsfeststellungs- und Anfechtungsklagen erhoben, die vor dem LG und dem OLG Köln in den ersten beiden Instanzen weitestgehend Erfolg hatten.
Entscheidung des BGH: Der dagegen gerichteten Revision der GmbH gab der BGH im Hinblick auf die Beschlüsse über die Abberufung, die Kündigung des Geschäftsführeranstellungsvertrags und die Ermächtigung zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen den Kläger statt. Im Hinblick auf die Beschlüsse über die Einziehung des klägerischen Geschäftsanteils habe hingegen das LG und OLG Köln zu Recht die Nichtigkeit des Beschlusses sowie der Wiederholungs- und Bestätigungsbeschlüsse festgestellt.
Es sei unbeachtlich, dass der Kläger bei der Erhebung der Klagen gegen die Einziehungsbeschlüsse nicht mehr als Inhaber des Geschäftsanteils in der Gesellschafterliste eingetragen war. Zur Sicherstellung der verfassungsrechtlich gebotenen Rechtsschutzmöglichkeit müsse dem nunmehr klagenden Gesellschafter die Anfechtungsbefugnis für die Klage gegen seinen Ausschluss oder die Einziehung seines Geschäftsanteils trotz sofortigem Wirksamwerden des Beschlusses erhalten bleiben. Die negative Legitimationswirkung in § 16 Abs. 1 S. 1 GmbHG, die grundsätzlich auch die Anfechtungsbefugnis umfasse, müsse in diesen Fällen eingeschränkt werden, um effektiven Rechtsschutz im Hinblick auf den bei Entzug der Mitgliedschaft gegebenen Eingriff in den durch Artikel 14 Abs. 1 GG Schutz des Eigentums zu gewährleisten.
Die Nichtigkeit des Einziehungsbeschlusses ergebe sich daraus, dass die beklagte GmbH bei der Beschlussfassung nicht über das zur Zahlung der Abfindung notwendige freie Vermögen verfügte. Auch die anschließenden Bestätigungsbeschlüsse hätten nicht zu einem wirksamen Einziehungsbeschluss geführt. Auch wenn grundsätzlich die (vorsorgliche) Wiederholung bzw. Bestätigung eines Einziehungsbeschlusses möglich sei, gelte dies nicht für die Wiederholung bzw. Bestätigung eines nichtigen Beschlusses, da diesen der materiell-rechtliche Mangel des Ausgangsbeschlusses ebenfalls anhaftet. Lediglich anfechtbare Beschlüsse seien einer Bestätigung bzw. Wiederholung zugänglich.
Im Übrigen scheiterte eine inhaltliche Überprüfung der angefochtenen Gesellschafterbeschlüsse jedoch an der fehlenden Anfechtungsbefugnis des Klägers. Die Beschlüsse über die Abberufung, die Kündigung des Geschäftsführerdienstvertrags und der Anspruchsverfolgung dem Kläger gegenüber verletzten die durch Artikel 14 Abs. 1 GG geschützte Gesellschafterstellung des Klägers in der GmbH nicht, so dass es auch nicht verfassungsrechtlich geboten sei, ihm entgegen der negativen Legitimationswirkung des § 16 Abs. 1 S. 1 GmbHG ausnahmsweise die Anfechtungsbefugnis zu erhalten.
Fazit: Das Urteil enthält wesentliche Erkenntnisse:
- Grundsätzlich ist die Heilung bzw. die vorsorgliche Wiederholung oder Bestätigung eines Gesellschafterbeschlusses einer GmbH möglich. Es muss insofern aber unterschieden werden zwischen anfechtbaren und nichtigen Beschlüssen. Die Heilung eines bloß anfechtbaren Gesellschafterbeschlusses ist ebenso wie im Aktienrecht auch im GmbH-Recht möglich. Ein von vornherein nichtiger Beschluss kann nicht durch einen späteren Beschluss bestätigt werden.
- Die gesetzlich in § 16 Abs. 1 S. 1 GmbHG angeordnete negative Legitimationswirkung zu Lasten des nicht mehr in der Gesellschafterliste eingetragenen Gesellschafters kann im Interesse der Rechtssicherheit zugunsten eines höherrangigen Grundrechtsschutzes eingeschränkt werden. Dies ist namentlich bei der Gewährung von Rechtsschutzmöglichkeiten gegen den Verlust der von Artikel 14 Abs. 1 GG geschützten Gesellschafterstellung der Fall.
- Offen lässt der BGH ausdrücklich die Frage, ob einem Gesellschafter nach seiner Streichung aus der zum Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste lediglich keine Mitgliedschaftsrechte gewährt werden müssen oder ob die GmbH ihn nicht mehr als Gesellschafter behandeln darf. Der BGH stellte allerdings klar, dass die GmbH jedenfalls bei Willensbildung in der Gesellschafterversammlung gehindert ist, einen nicht mehr in der Gesellschafterliste Eingetragenen wie einen Gesellschafter zu behandeln.
- Der einstweilige Rechtsschutz gegen die Aufnahme einer neuen Gesellschafterliste kann folglich große Bedeutung im Zusammenhang mit dem Erhalt der Klagemöglichkeiten eines ausgeschlossenen Gesellschafters gegen nach seinem streitigen Ausschluss ergangene Gesellschafterbeschlüsse haben. Denn ist ein Gesellschafter nicht mehr in der Gesellschafterliste aufgeführt, kann er seine mitgliedschaftlichen Rechte nicht mehr ausüben – ausgenommen hiervon ist die Anfechtung des Einziehungsbeschlusses.
Verjährungsbeginn des Abfindungsanspruchs bei strittigem Ausschluss eines Gesellschafters
(Urteil vom 18.05.2021 – II ZR 41/20)
Sachverhalt: Im April 2009 hatte eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts („GbR“) einen ihrer Gesellschafter aus einem wichtigen Grund ausgeschlossen. Dieser wehrte sich sechs Jahre lang gerichtlich gegen den Ausschließungsbeschluss bis dieser 2015 rechtskräftig feststand. 2015 machte der Kläger auch erst die ihm nach dem Gesellschaftsvertrag im Falle eines Ausschlusses zustehende Abfindung geltend, woraufhin die Beklagten die Einrede der Verjährung erhoben. Der Kläger unterlag vor dem LG und KG Berlin, die jeweils annahmen, dass etwaige Ansprüche des Klägers auf Abfindung mit Ablauf des 31.12.2012 verjährt seien.
Entscheidung des BGH: Dem widersprach der BGH. Er stellte zunächst fest, dass der Abfindungsanspruch grundsätzlich der dreijährigen Regelverjährung nach § 195 BGB unterliegt und mit dem Ausscheiden des Klägers in 2009 auch bereits entstanden sei. Die Verjährungsfrist beginne jedoch nach § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB erst zu laufen, sobald der Kläger alle Tatsachen kenne, die den Anspruch begründeten. Davon sei hier erst im Jahr 2015 auszugehen gewesen. Bis zu diesem Zeitpunkt, zu dem die Wirksamkeit des Ausschlusses rechtskräftig feststand, habe eine unsichere und zweifelhafte Rechtslage vorgelegen, die selbst ein rechtskundiger Dritter nicht zuverlässig hätte einschätzen können. Auch müsse der Kläger sich in Widerspruch zu seinem eigentlich verfolgten Rechtsschutzziel des Verbleibens in der Gesellschaft setzen, wenn er vor der rechtskräftigen Entscheidung über die Wirksamkeit des Ausschlusses seinen Abfindungsanspruch geltend machen muss. In diesen Fällen fehle es an der Zumutbarkeit der Klageerhebung als übergreifender Voraussetzung für den Verjährungsbeginn.
Fazit: Bereits vor dieser Entscheidung hatte der BGH für den Beginn des Laufs von Verjährungsfristen in Ausnahmefällen eine Zumutbarkeit der Klageerhebung als übergreifende Voraussetzung angenommen, wenn die dem Anspruch zugrundeliegende Rechtslage unübersichtlich oder zweifelhaft ist. In diesen Fällen soll trotz Vorliegen der nach dem Wortlaut der entsprechenden Verjährungsvorschrift erforderlichen Kenntnis über die tatsächlichen Umstände des Anspruchs die Rechtsunkenntnis den Verjährungsbeginn hinausschieben.
Eine solche unübersichtliche und zweifelhafte Rechtslage hat der BGH nunmehr auch ausdrücklich für einen Gesellschafter bejaht, der sich Im Klageweg gegen die Wirksamkeit seines Ausschlusses wehrt. Sein Abfindungsanspruch soll demzufolge regelmäßig erst ab Rechtskraft des Ausschlusses verjähren. Dem ist aus Gründen der Klarheit, aus Sicht der Prozessökonomie und zum Wohle aller Beteiligten, zuzustimmen. Der ausgeschlossene Gesellschafter ist nicht gezwungen, zur Verhinderung der Verjährung neben der Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit des Ausschlusses trotz noch laufendem Verfahren mit offenem Ausgang zusätzlich Klage auf Zahlung der Abfindungsvergütung zu erheben.
Vorsicht dürfte jedoch hinsichtlich dieses prozessökonomischen Ansatzes in besonders eindeutig gelagerten Ausschlusssituationen geboten sein, da der BGH eine Unzumutbarkeit der Klageerhebung lediglich „im Regelfall“ angenommen hat.
Anwendungsbereich der Zustimmungspflicht für Beratungsverträge zwischen der AG und ihrem Aufsichtsrat
(Urteile vom 22.06.2021 – II ZR 225/20 und vom 29.06.2021 – II ZR 75/20)
Sachverhalt: Die Klägerin im ersten Fall ist Vermögensverwalterin einer AG und betreute diese bei Kapitalmaßnahmen. Die Klägerin hatte die Beklagte 1 mit der Erbringung von Beratungsleistungen an die AG unterbeauftragt. Der Geschäftsführer und alleinige Gesellschafter der Beklagten 1, der Beklagte 2, ist zugleich Aufsichtsratsmitglied der AG. Weder Hauptversammlung noch Aufsichtsrat der AG hatten dem Vertrag zwischen Klägerin und Beklagter 1 über die Unterbeauftragung zugestimmt. Die Klägerin verlangt von den Beklagten die Rückzahlung von Beträgen, die sie der Beklagten 1 für deren Beratung der AG gezahlt hat.
Im zweiten Fall war der Beklagte Aufsichtsratsvorsitzender der klagenden AG. Er war gleichzeitig Vorstandsvorsitzender einer weiteren AG, mit der die klagende AG einen Beratervertrag geschlossen hatte, ohne ihn dem Aufsichtsrat vorzulegen. Für die durch den Beklagten erbrachten Beratungsleistungen zahlte die klagende AG an das Beratungsunternehmen eine Vergütung, deren Rückzahlung die AG nun gegen den Beklagten geltend macht.
Entscheidung des BGH: In beiden Fällen bejahte der BGH mit Verweis auf den Regelungszweck des § 114 AktG den Rückzahlungsanspruch gegen die Beklagten, da die nach § 114 Abs. 2 AktG erforderliche Zustimmung des Aufsichtsrats für die jeweiligen Beratungsverträge fehle. Sowohl auf einen Beratungsvertrag zwischen der direkten Vertragspartnerin einer AG und einer als Subunternehmerin tätigen Gesellschaft eines Aufsichtsratsmitglieds der AG als auch auf einen Beratungsvertrag zwischen einer AG und einer Gesellschaft, deren gesetzlicher Vertreter ihr Aufsichtsratsmitglied ist, finden nach dem BGH die §§ 113, 114 AktG Anwendung. Im ersten Fall sei der Beratungsvertrag wegen Verstoßes gegen § 113 AktG nicht genehmigungsfähig und damit gemäß § 134 BGB nichtig. Er beinhalte Tätigkeiten, die zur Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrat gehörten. Im zweiten Fall ließ der BGH diese Frage offen, da eine Zustimmung bereits nicht behauptet worden sei.
Fazit: Die Entscheidungen verdeutlichen einmal mehr, dass der BGH den Anwendungsbereich der §§ 113, 114 AktG im Sinne eines Umgehungsschutzes weit versteht. Die Entscheidungen reihen sich nahtlos in die bereits in der Vergangenheit vom BGH entschiedenen Fällen zum Anwendungsbereich der §§ 113, 114 AktG ein. So hat der BGH bereits die entsprechende Anwendung des § 114 AktG für Fälle bejaht, in denen der Beratungsvertrag zwischen der AG und einer Gesellschaft zustande kommt, dessen Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter Mitglied des Aufsichtsrats ist (Urteil vom 03.07.2006 – II ZR 151/04). Gleiches gilt in Fällen, in denen der Beratungsvertrag zwischen der AG und einer Gesellschaft zustande kommt, an der das Aufsichtsratsmitglied (nicht notwendig beherrschend) beteiligt ist (Urteil vom 20.11.2006 – II ZR 279/05).
Mit den beiden neuen Entscheidungen ist nun geklärt, dass auch die Einschaltung eines Dritten, der das Unternehmen eines Aufsichtsratsmitglieds für Tätigkeiten für die AG unterbeauftragt, von § 114 AktG erfasst wird. Es macht also keinen Unterschied, ob die AG direkt eine Vergütung an sein Aufsichtsratsmitglied zahlt oder dem Aufsichtsratsmitglied eine solche über einen Vertragspartner der AG mittelbar zukommt.
Auch ist keine Beteiligung des Aufsichtsratsmitglieds am Unternehmen erforderlich, mit dem die AG einen Beratungsvertrag schließt. Es genügt aus Sicht des BGH die Position eines gesetzlichen Vertreters, der auch keine vom wirtschaftlichen Erfolg des Beratungsunternehmens abhängige Vergütung beziehen muss. Es reicht insofern der nur mittelbare Vorteil für das Aufsichtsratsmitglied, dass mit dem Beratungshonorar der Gesellschaft, für die er als gesetzlicher Vertreter tätig ist, seine feste Vorstandsvergütung erwirtschaftet wird.
In jedem Fall ist es – wie der BGH vorliegend nochmals deutlich macht – unerlässlich, in Verträgen, die dem Anwendungsbereich von §§ 114, 113 AktG unterfallen, eindeutige Formulierungen zu dem vereinbarten Pflichtenkreis und der geschuldeten Vergütung aufzunehmen, um sowohl Tätigkeiten im Pflichtenkreis eines Aufsichtsratsmitglieds als auch verdeckte Sonderzuwendungen auszuschließen.
Ausschüttung von Gewinnvorträgen als darlehensgleiche Forderung
(Urteil vom 22.07.2021 – IX ZR 195/20)
Sachverhalt: Der Kläger ist Insolvenzverwalter über das Vermögen einer GmbH, deren Alleingesellschafterin die Beklagte war. Nachdem die Beklagte im September 2009 zunächst beschloss, den im Geschäftsjahr 2008 erwirtschafteten Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen, fasste sie kurz darauf einen weiteren Gesellschafterbeschluss zur Ausschüttung eines Teils des entsprechenden Gewinns. Die Überweisung des Ausschüttungsbetrags an die Beklagte erfolgte eine Woche später. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens ca. sechs Monate nach der Ausschüttung, forderte der Kläger von der Beklagten die Rückzahlung des Ausschüttungsbetrags. Das LG Bayreuth und das OLG Bamberg gaben der Klage in den ersten beiden Instanzen statt.
Entscheidung des BGH: Dem stimmte der BGH zu. Er bejahte einen Rückzahlungsanspruch des Insolvenzverwalters, da die Gewinnausschüttung an den Alleingesellschafter als Befriedigung einer Forderung, die einem Gesellschafterdarlehen wirtschaftlich entspreche, gemäß §§ 39 Abs. 1 Nr. 5, 135 Abs. 1 S. 2 InsO anfechtbar gewesen sei. Indem sich der Gesellschafter bei der Fassung des Gewinnverwendungsbeschlusses entscheide, den Jahresgewinn nicht auszuschütten, sondern auf neue Rechnung vorzutragen, treffe der Gesellschafter eine einer Darlehensgewährung entsprechende Finanzierungsentscheidung zugunsten der Gesellschaft. Er überlasse der Gesellschaft wie bei einem Darlehen vorübergehend Kapital und verschaffe ihr temporär Liquidität. Dies gelte allerdings nicht, wenn und soweit die Gewinnausschüttung zum Zeitpunkt des Beschlusses über den Gewinnvortrag nicht hätte vorgenommen werden dürfen, beispielsweise weil eine Unterbilanz herbeigeführt worden wäre.
Fazit: Die Entscheidung des BGH zum Beschluss über einen Gewinnvortrag als darlehensgleiche Forderung reiht sich konsequent in die bereits in den letzten Jahren ergangenen Entscheidungen zu der Frage ein, welche Rechtshandlungen einem Darlehen wirtschaftlich entsprechen und demzufolge anfechtbar sind, wenn sie im Jahr vor dem Insolvenzeröffnungsantrag erfolgten. So hat der BGH beispielsweise 2020 (Urteil vom 17.12.2020 – IX ZR 122/19) entschieden, dass eine darlehensgleiche Forderung vorliegt, wenn die auf einen Gewinnverwendungsbeschluss begründete Gewinnforderung des Gesellschafters nicht zeitnah ausgeschüttet wird. 2019 stellte er fest, dass auch die Forderung eines Gesellschafters als darlehensgleich zu beurteilen sein könne, wenn der Gesellschafter einen fälligen Anspruch darlehensfremder Art nicht gegen die Gesellschaft geltend macht (Urteil vom 11.07.2019 – IX ZR 210/18).
Da die Frage der Qualifizierung eines Gewinnvortrags als darlehensgleiche Forderung bislang in Literatur und obergerichtlicher Rechtsprechung umstritten war, hat das Urteil für die Praxis zumindest insoweit eine Klärung gebracht, als dass es die Frage für eine Ausschüttung an einen Alleingesellschafter beantwortet hat. Nicht abschließend geklärt bleiben die Fälle bei Vorliegen von mehreren Gesellschaftern, insbesondere wenn kein Gesellschafter über die notwendige Mehrheit verfügt.
Lesen Sie für eine detaillierte Betrachtung dieser Entscheidung sowie die Auswirkungen auf die Finanzierungspraxis und auf M&A-Transaktionen unseren Beitrag „Ausschüttungen an Gesellschafter nach Gewinnvortrag in der Insolvenz anfechtbar“.
Festsetzung einer Geldbuße gegen den Rechtsnachfolger
(Urteile vom 08.03.2021 – KRB 86/20 und 23.03.2021 – 6 StR 452/20)
Sachverhalt 1: In einem Kartellbußgeldverfahren hatte das OLG Düsseldorf 2012 gegen eine GmbH & Co. KG wegen Beteiligung ihrer Leitungspersonen an bis Ende November 2007 andauernde Kartellabsprachen nach § 30 Abs. 1 OWiG eine Verbandsgeldbuße wegen Kartellordnungswidrigkeiten verhängt. Der BGH hob die Entscheidung im Rechtsbeschwerdeverfahren auf und verwies das Verfahren zurück an das OLG Düsseldorf. Nach dem Austritt ihrer Komplementärin und Anwachsung des Vermögens auf ihre einzige Kommanditistin wurde die GmbH & Co. KG zum 01.01.2019 noch vor Erlass des weiteren Urteils des OLG Düsseldorf aufgelöst. Das OLG Düsseldorf lehnte daraufhin eine bußgeldrechtliche Verantwortlichkeit der Rechtsnachfolgerin der GmbH & Co. KG ab, da § 30 Abs. 2a OWiG nicht rückwirkend auf eine vor seinem Inkrafttreten beendete Anknüpfungstat angewendet werden könne.
Entscheidung 1 des BGH: Der Kartellsenat des BGH bestätigte die Sichtweise des OLG Düsseldorf. Der mit der 8. GWB-Novelle zum 30.06.2013 eingefügte § 30 Abs. 2a OWiG sei ausschließlich dann anwendbar, wenn sowohl die Gesamtrechtsnachfolge als auch die Beendigung der Straftat oder Ordnungswidrigkeit nach dem Inkrafttreten des § 30 Abs. 2a OWiG erfolgt ist. Ebenso wie § 30 Abs. 1 OWiG sei auch § 30 Abs. 2a OWiG eine sanktionsbegründende Norm. § 30 Abs. 1 OWiG bestimme eine eigene bußgeldrechtliche Verantwortlichkeit des Verbands für Taten seiner Leitungspersonen und keine Haftung im Sinne eines Einstehenmüssens für eine fremde Bußgeldschuld. § 30 Abs. 2a OWiG ordne an, dass der Rechtsnachfolger in eine bestehende Verantwortlichkeit des Verbands eintritt. Die Vorschrift begründe für die Gesamtrechtsnachfolge die Verantwortlichkeit der Person eines zu ahndenden Verbands und bestimme somit die eigene bußgeldrechtliche Verantwortlichkeit des Rechtsnachfolgers. Demzufolge könne die Vorschrift nicht rückwirkend auf Fälle angewendet werden, in denen die Straftat oder Ordnungswidrigkeit bereits vor ihrem Inkrafttreten beendet gewesen sei.
Sachverhalt 2: Der Angeklagte im Strafverfahren vor dem 6. Strafsenat war Geschäftsführer eines Bauunternehmens. Er erhielt vom Mitangeklagten Informationen aus einem großen Vergabeverfahren eines Unternehmens, für das der Mitangeklagte tätig war. Der Mitangeklagte förderte stark die Vergabe des Auftrags an das Bauunternehmen, dessen Geschäftsführer der Mitangeklagte war. Dies erwies sich als erfolgreich. Im Gegenzug führte das Bauunternehmen am Privathaus des Mitangeklagten kostenlos Arbeiten aus. Einige Zeit später wurde das Bauunternehmen durch Übertragung des Vermögens als Ganzes unter Auflösung auf die Nebenbeteiligte verschmolzen, deren Geschäftsführer ebenfalls der Angeklagte war. Das LG Neuruppin verurteilte den Angeklagten wegen Bestechung im geschäftlichen Verkehr gemäß § 299 Abs. 2 StGB zu einer Geldstrafe und die Nebenbeteiligte zu einer Verbandsgeldbuße, die es auf § 30 Abs. 2a OWiG stützte.
Entscheidung 2 des BGH: Die Festsetzung der Geldbuße gegen die Nebenbeteiligte hielt im Revisionsverfahren vor dem 6. Strafsenat des BGH stand. Mit der Verschmelzung sei der Anwendungsbereich der Festsetzung einer Geldbuße gegen den Rechtsnachfolger grundsätzlich eröffnet, da die Gesamtrechtsnachfolge nach Inkrafttreten der Regelung in § 30 Abs. 2a OWiG zum 30.06.2013 erfolgt sei. Das ahndungsrechtliche Rückwirkungsverbot stehe der Festsetzung der Geldbuße gegen den Rechtsnachfolger nicht entgegen, wenn zwar die Gesamtrechtsnachfolge erst nach Inkrafttreten der Vorschrift des § 30 Abs. 2a OWiG stattfand, die Anknüpfungstat, hier also die Bestechung im geschäftlichen Verkehr, vor diesem Zeitpunkt bereits beendet war. Angesichts des Normzwecks, dem Entgegenwirken von Umgehungen drohender bußgeldrechtlicher Sanktionen durch die gezielte Wahl gesellschaftsrechtlicher Gestaltungen, und angesichts des Rechtscharakters der Vorschrift als bloße „Überleitungsnorm“ sei den verfassungsrechtlichen Anforderungen des Artikel 103 Abs. 2 GG an das Gesetzlichkeitsprinzip dann Genüge getan, wenn § 30 Abs. 2a OWiG im Zeitpunkt der Gesamtrechtsnachfolge bereits in Kraft getreten war. Bei § 30 Abs. 2a OWiG handele es sich nicht um einen eigenständigen Ahndungstatbestand gegenüber dem Rechtsnachfolger. Hierfür spreche insbesondere, dass die Geldbuße gegen den Rechtsnachfolger nicht nach den für ihn geltenden Umständen bemessen werde, sondern vielmehr eine hypothetische Bußgeldbemessung durchzuführen sei, aus der sich ergebe, welche Geldbuße gegenüber dem Rechtsvorgänger angemessen gewesen wäre.
Fazit: Der 6. Strafsenat und der Kartellsenat beurteilen die Anwendbarkeit von § 30 Abs. 2a OWiG gegensätzlich auf Fälle, in denen die Rechtsnachfolge des die Geldbuße tragenden Unternehmens nach Inkrafttreten dieser Norm wirksam wurde, die Anknüpfungstat für die Geldbuße aber schon vorher beendet war. Hintergrund ist die Einordnung von § 30 OWiG durch den Kartellsenat des BGH als „sanktionsbegründende Norm“, während der 6. Strafsenat des BGH die Vorschrift als eine „bloße Überleitungsnorm“ einordnet. Der 6. Strafsenat verneinte ausdrücklich die Pflicht zur Anrufung des Großen Strafsenats nach § 132 Abs. 2 GVG. Diese Pflicht besteht, wenn ein Senat in einer Rechtsfrage von der Entscheidung eines anderen Senats abweicht. Der 6. Strafsenat bezog sich dabei allerdings nicht auf die aktuelle Entscheidung des Kartellsenats, sondern auf die Entscheidung des 6. Strafsenats vom 16.12.2014 (KRB 47/13). Dieser lag ein Sachverhalt zugrunde, in dem sowohl Anknüpfungstat als auch Rechtsnachfolge vor Inkrafttreten von § 30 Abs. 2a OWiG abgeschlossen waren.
Für die gesellschaftsrechtliche Transaktionspraxis sind beide Entscheidungen zu beachten. Die Möglichkeiten, durch gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen einer Geldbuße zu entgehen, werden – insbesondere durch die öffentliche Diskussion im Fall der „Wurstlücke“ – immer weiter eingeschränkt. Die „Wurstlücke“ erhielt ihren Namen, nachdem sich einzelne Wursthersteller nach Verhängung eines Kartellbußgelds wegen Preisabsprachen durch unternehmensinterne Umstrukturierungen der Zahlung des Bußgelds wegen einer damals noch im Kartellrecht geltenden gesetzlichen Haftungslücke entziehen konnten. Die Einschränkung der Möglichkeit zum Entgehen von Geldbußen steigert die Notwendigkeit für den Erwerber eines Unternehmens, Bußgeldrisiken für zu erwerbende Unternehmen aufgrund strafrechtlichen Fehlverhaltens deren Geschäftsführung im Erwerbsprozess sorgfältig zu prüfen. Die Entscheidung des 6. Strafsenats erhöht das Risiko eines Erwerbers eines Unternehmens auf Situationen, in denen das Fehlverhalten vor Inkrafttreten von § 30 Abs. 2a OWiG erfolgte.
Unentdeckte Bußgeldrisiken durch zurückliegendes Fehlverhalten der Geschäftsführung eines zu erwerbenden Unternehmen bergen nicht nur direkte finanzielle Risiken, sondern können darüber hinaus zu einem Reputationsverlust beim erworbenen Unternehmen führen. Zudem droht seit Dezember 2021 als weitere Folge die Eintragung im vom Bundeskartellamt geführten Wettbewerbsregister, die durch den zwingenden Ausschluss von öffentlichen Vergaben existenzvernichtenden Charakter haben kann. Demzufolge sollten etwaige Bußgeldrisiken durch entsprechende eindeutig formulierte Garantien bzw. Freistellungen im Unternehmenskaufvertrag umfassend abgesichert werden.
Annahme des Übernahmeangebots ist Voraussetzung für den Anspruch auf angemessene Gegenleistung
(Urteile vom 23.11.2021 – II ZR 312/19 und II ZR 315/19 – Celesio II)
Sachverhalt und Hintergrund: Die beiden BGH-Entscheidungen handeln von der Übernahme der Celesio AG durch den US-Konzern McKesson. Sie nehmen zu grundsätzlichen Fragen des Rechtsschutzes der Aktionäre der Zielgesellschaft bei öffentlichen Übernahmen Stellung. Der BGH hatte zuvor in einem 2017 abgeschlossenen Verfahren, dem ebenfalls die Übernahme der Celesio AG zugrunde lag, entschieden, dass Aktionäre, die das Übernahmeangebot angenommen haben, einen Anspruch auf angemessene Gegenleistung nach den übernahmerechtlichen Mindestpreisregeln haben, und dass die von der Beklagten für den Erwerb von Wandelschuldverschreibungen vor Abgabe des Übernahmeangebots gezahlten Preise bei der Ermittlung der Gegenleistung zu berücksichtigen sind (Urteil vom 07.11.2017 – II ZR 37/16 – Celesio I). Die annehmenden Aktionäre hatten danach einen Anspruch auf eine angemessene Gegenleistung in Höhe von EUR 30,95 je Aktie, während der Bieter ursprünglich nur EUR 23,50 geboten hatte.
Im Celesio II-Fall klagten nun Aktionäre, die das Übernahmeangebot nicht angenommen haben. Sie verlangten Schadensersatz von dem Bieter mit der Begründung, dass sie das Übernahmeangebot angenommen hätten, wenn der Bieter die angemessene Gegenleistung in Höhe von EUR 30,95 je Aktie geboten hätte. LG und OLG Stuttgart wiesen die Klage in den ersten Instanzen ab.
Entscheidung des BGH: Der BGH lehnte einen Anspruch der nicht annehmenden Aktionäre gegen den Bieter im Einklang mit der herrschenden Auffassung in der Literatur ebenfalls ab. § 31 Abs. 1 S. 1 WpÜG vermittele nur den Aktionären, die das Angebot annehmen, einen Anspruch auf eine angemessene Gegenleistung. Neben Wortlaut, Gesetzessystematik und Gesetzesmaterialien spreche die Interessenlage von Bieter und Erwerber für diese Sichtweise. Würde man einen Anspruch auch der nicht annehmenden Aktionäre auf Zahlung der angemessenen Gegenleistung anerkennen, wäre der Bieter mit Veröffentlichung der Angebotsunterlage auf zunächst unabsehbare Zeit und verschuldensunabhängig zur Übernahme der Aktien der Zielgesellschaft zu dem nach den Mindestpreisregeln maßgeblichen Preis verpflichtet. Dies widerspräche den im WpÜG verankerten Grundsätzen der raschen Durchführung des Angebotsverfahrens ohne unnötig lange Behinderung der Geschäftstätigkeit der Zielgesellschaft und ohne Marktverzerrungen (§ 3 Abs. 4 und 5 WpÜG). Ferner würden für die Aktionäre der Zielgesellschaft entgegen dieser Zielsetzung Anreize geschaffen, das Angebot während der Annahmefrist zunächst nicht anzunehmen, zumindest wenn die Veräußerung zum Mindestpreis zeitlich unbegrenzt möglich wäre.
Auch stelle die Pflicht des Bieters nach § 31 Abs. 1 S. 1 WpÜG eine angemessene Gegenleistung zu bieten, keine vorvertragliche Nebenpflicht gem. §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB gegenüber den Aktionären der Zielgesellschaft dar. Die den Bieter treffenden vorvertraglichen Rücksichtspflichten seien auf die Information der Aktionäre über die für die Beurteilung der Angemessenheit der Gegenleistung maßgeblichen Umstände im Rahmen der Angebotsunterlage begrenzt. Dem Bieter sei es nicht zuzumuten, unabhängig von einem Vertragsschluss durch Annahme des Angebots gegenüber allen Aktionären der Zielgesellschaft das aus rechtlichen oder tatsächlichen Unsicherheiten folgende Risiko einer zutreffenden Bemessung der Gegenleistung zu tragen. Ein solcher auf das Erfüllungsinteresse gerichteter Anspruch würde die Transaktionsrisiken erhöhen und die Planbarkeit des Übernahmeverfahrens erschweren. Dies sei vor allem dann nicht gerechtfertigt, wenn der betreffende Aktionär wie im Celesio II-Fall umfassend informiert war. Ob Aktionäre, die das Angebot nicht annehmen, einen Schadensersatzanspruch gegen den Bieter gem. §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 31 Abs. 1 S. 1 WpÜG zusteht, ließ der BGH ausdrücklich offen.
Schließlich verneint der BGH die Schutzgesetzeigenschaft des § 31 Abs. 1 S. 1 WpÜG im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB im Einklang mit der herrschenden Auffassung in der Literatur.
Fazit: Die Celesio II-Entscheidung liegt auf einer Linie mit vorhergehenden BGH-Entscheidungen und der herrschenden Auffassung in der Literatur zum Rechtsschutz der Aktionäre der Zielgesellschaft bei öffentlichen Übernahmen. Neben der Celesio I-Entscheidung sind insbesondere die BKN-Entscheidung (Urteil vom 11.06.2013 – II ZR 80/12) und die Postbank-Entscheidung (Urteil vom 29.07.2014 – II ZR 353/12) zu nennen. Insofern ist die Celesio II-Entscheidung keine Überraschung. In der Sache ist sie zu begrüßen. Offen bleibt die Frage, ob ein Schadensersatzanspruch der nicht annehmenden Aktionäre aus culpa in contrahendo denkbar ist, wenn die Informationen in der Angebotsunterlage über die mindestpreisrelevanten Sachverhalte unzureichend waren. Deshalb ist zu empfehlen, die entsprechenden Sachverhalte in der Angebotsunterlage sorgfältig darzustellen.
Wir danken Dr. Birgit Koch, Senior Knowledge Management Advisor der Praxisgruppen Corporate und M&A, für die Unterstützung in der Erstellung des Beitrags.
Bestens
informiert
Jetzt unseren Newsletter abonnieren, um zu aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
Jetzt anmelden